|
Stefan Krappweis, TU-Berlin, ISR - Fachgebiet Orts-, Regional- und Landesplanung |
Flächennutzungsplanung in Brandenburg
nach der Wende
Der
Flächennutzungsplan hat bei der ersten Welle von Siedlungserweiterungen in der
Nachwendezeit bei den brandenburgischen Gemeinden insgesamt so gut wie keine
Rolle gespielt. Gefragt war hier der schnelle Weg zum Planungsrecht über den
“vorzeitigen” B-Plan, der in den Neuen Ländern bis zum 31.12.1997 auch ohne
“dringende Gründe” vor dem FNP aufgestellt werden konnte,[1]
und den Vorhaben- und Erschließungsplan sowie Abrundungssatzungen (§ 34 Abs. 4
BauGB), um so Wohnbau- und Gewerbeprojekte schneller abwickeln zu können. Hinzu
kam, dass zahlreiche kleinere Gemeinden einen FNP zur städtebaulichen Ordnung
nicht für erforderlich hielten und statt dessen mithilfe des “selbständigen” B-Plans
(§ 8 Abs. 2 BauGB) planten. Dies betrifft immerhin 460 Gemeinden (27 %)[2]. Nur in wenigen Fällen kann man von einem
Parallelverfahren von Flächennutzungsplänen und daraus entwickelten Bebauungsplänen
sprechen (§ 8 Abs. 3 BauGB). Eine geordnete Entwicklung von verbindlichen
Bauleitplänen aus dem vorbereitenden F-Plan kam quasi nicht vor (§ 8 Abs. 2
BauGB). Ende 1997, ein Jahr nachdem die Abschreibungsvergünstigungen und damit
ein zugkräftiger Motor für den Aufbau Ost wegfielen, verfügten nur 4 % der
Gemeinden über einen genehmigten FNP.[3]
In einer
zweiten Welle wurden dann Siedlungserweiterungen auf der Grundlage von
Flächennutzungsplänen vorbereitet. Von den im Jahr 1998 insgesamt 1.688 Gemeinden
Brandenburgs waren 1.158 (69 %) mit der Aufstellung eines FNP befasst. 678
Gemeinden (59 %) stellten ihren eigenen FNP auf, 480 Gemeinden (41 %) haben sich für einen
gemeindeübergreifenden Plan entschlossen. Davon wiederum 233 Gemeinden (20 %)
in dem Verfahren nach § 204 BauGB (gemeinsamer Flächennutzungsplan), 59
Gemeinden (5 %) nach § 205 BauGB (Planungsverband), und 188 Gemeinden (16 %)
übertrugen die Zuständigkeit für den FNP auf das Amt.
Flächennutzungspläne
in Brandenburg nach der Art des Planverfahrens
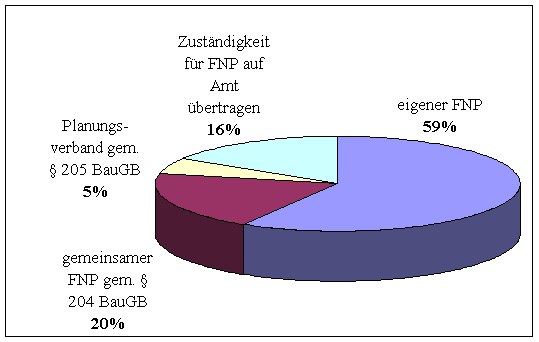
“Eine
vergleichbar hohe Zahl gemeindeübergreifender Planungen hat es in den alten
Ländern nie gegeben”.[4]
Zu
den günstigen Voraussetzungen in Brandenburg zählten dabei:[5]
-
aktive Förderung durch das MSWV und deren Genehmigungsbehörde
LBBW
-
geringe Bevölkerungsdichte bzw. hohe Zahl
kleiner Gemeinden
-
Zusammenfassung der Gemeinden in Ämtern seit
1993
-
gemeinsamer Planungszeitpunkt (Parallelität des
Aufstellungserfordernisses)
-
gemeinsamer Planungsanlass (z.B. gemeindeübergreifender
Windpark).