Verkehrskosten
(Bund, Länder, Gemeinden, Bahn, Flughäfen)
|
Instrument |
Einführung |
Einnahme |
Kostenbelastung (pro Jahr) |
Regelung |
Ziel |
(Raum-)Wirkung |
Ländervergleich |
Diskussion |
|
|
(Bund) |
1879 Petroleumzoll 1930 Mineralölst. 1939 Dieselöl 1960 Heizöl letzte Erhöhungen: 1991, 1994 MineralölsteuerG |
34 Mrd € (1999) (Kraftstoffe) |
Benzin: 1.050 l x 0,98 DM = 1029 DM Diesel: 1.050 lx0,62 DM=651 DM (12.000 km /Jahr) |
Besteuerung: Mineralöl als Kraftstoff, Heizstoff und
zum Antrieb von Gasturbinen Steuerbefreiung: Flugzeugbetrieb, Schiffsbetrieb Steuersätze incl. Ökosteuer:
Benzin Diesel 2001: 1,16 0,80 DM 2002: 0,62 0,44 € 2003: 0,65 0,47 € Begünstigt: ÖPNV (50% Erlass) , Agrardiesel 0,50 DM/l |
Staatliche Einnahme auf Verbrauch (Benutzung) zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Senkung des Verbrauchs (Ressourcenschutz) und der Importabhängigkeit v. Mineralöl. (Leistungsbilanz) |
Preisanstieg senkt Nachfrage (Verbrauch):
- geringere Verkehrsleistungen des MIV (abnehmende
Zentrifugalkräfte in Stadtregionen) - geringerer spezifischer Energieverbrauch (Effizienzsteigerung,
Sparautos) - Veränd. Kraftstoffabsatz (129 ha/Tag = 470 km²/a vgl. Berlin= 890 km²) |
(+6%/a, 1,74 DM) Benzin- und Dieselpreise in Europa |
Umfrage t-online zur Ökosteuer: abschaffen: 73 % nicht erhöh.: 11 % erhöhen: 15 % |
|
|
Ökosteuer (Bund) |
1999-2003 (je 6 Pf) MineralölsteuerG |
? |
ab 2003: 1.050 l x0,30 DM=315 DM |
s.o. |
Rohstoffverbrauch verteuern, Arbeit verbilligen (Lohnnebenkosten: Rentenbeitrag
von 20,3 auf 19,3 % gesenkt) Nachfrage nach energiesparenden und ressourcenschonenden Produkten erhöhen Ý CO2-Anteil |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
|
|
(Bund und Länder) |
1955 km-Pauschale 2001 Entferungsp. Eink.-SteuerG |
Steuermindereinnahme 4,2 Mrd € (?) |
ggü. altem Kilometergeld bei 15 km: Auto: 34-78 € ÖPNV: 124-273 € bei 25/30 km: Auto: 0-128 € ÖPNV: 150-847 € |
Steuerlich absetzbares Kilometergeld (Werbungskosten) für Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz (einfacher Weg) Ø 8 km Entfernung 1998, Arbeitswegstatistik |
Förderung der beruflichen Mobiltät Entlastung der Pendler von Mineralölsteuererhöhungen |
"Zersiedlungsprämie" wachsende Pendeldistanzen Ausufern der Stadtregionen Verstärkung des Stadt-Land-Preisgefälles "Absatzförderung Zweitwagen" |
ohnegleichen |
|
|
|
Kraftfahrzeugsteuer (Länder) |
|
7 Mrd. € (2000) |
Beispiel 1.5 l Hubraum (ab 2001): "Dreckschleuder": Benzin: 380 € Diesel: 564 € Euro 3 u. 4 und 3-l-Auto: Benzin: 77 € Diesel: 207 € |
Steuer abhängig von Hubraum und Schadstoffklassen: Einstiegspreis je angefangene 100 cm³ Hubraum: 10 DM Ottomotor 27 DM Dieselmotor befristete Steuerbefreiung: - Euro3 und
-4-Motoren - 3-Liter-,
5-Liter-Autos - Elektroautos |
1. Staatliche Einnahme auf Besitz/
Haltung mit sozialer
Komponente (Hubraum-bezog.) 2. Reduzierung Luftschadstoffe - Nachrüstung von Altautos mit Katalysator - Entwickl.- und Absatzförd. für schadstoffarme Neuwagen 3. Ressourcenschutz (Verbrauchssenkung) |
Belastung des ruhenden MIV Anreiz gegen KFZ-Haltung bzw. Zweit- und Drittwagen Steuerung des Ausstattungsniveaus ? (PKW/1000 EW)
|
|
|
|
|
Verschrottungsprämie Diskussion |
|
|
ca. 1.000-2.000 DM |
staatl. Prämie für Verschrottung bei gleichzeitigem Neuwagenkauf |
Ersetzen von 7 Mio. Altwagen durch schadstoffarme Neuwagen Reduzierung der Luftschadstoffe |
|
Spanien 1.500 DM Frankreich |
|
|
|
LKW-EuroVignette
(Bund) |
1.1.1995 |
2000: 836 Mio. DM / Jahr |
Gebühr pro Jahr (ab 1.4.01) 3 Achsen: Euro O: 960 € Euro II 750 € 4 Achsen: Euro 0: 1.550 € Euro II 1.250 € |
Zeit-, achs- und schadstoffabhängige Gebühr (LKW-gebunden, nicht
übertragbar) - Tag, Woche, Monat, Jahr - bis 3 Achsen, > 3 Achsen Schadstoffkl. Euro 0, Euro I, Euro II oder besser |
gleiche Wettbewerbsbedingungen bei Straße und Schiene, Verursachergerechte Anlastung der Wegekosten, Umstieg von der Steuer- zur Nutzerfinanzierung "Instandhaltungskrise" bei Bundesfernstraßen beenden (Ein 40-Tonner belastet die Straße durch sein Gewicht etwa 60.000-mal mehr als ein PKW) |
Verbesserung Auslastung Vermeidung Leerfahrten Verlagerung auf Schiene Verringerung der Produktions- und Distributionskilometer ? (Bsp.
Joghurtbecher 3.500 km ohne EH) Stauvermeidung |
Österreich: Tagesvignette Holland, Belgien: Eurovignette (wie Deutschland) Schweiz: 70 Pfenning/km |
|
|
|
(Bund) |
Regelung in zukünftiger RVO |
ca. 2 Mrd. € pro Jahr |
Ø 0,15 € / km Bsp. LKW 40 Tonnen u. 100.000
km Jahresfahrleistung: ca. 15.000 € (+ 10% Betriebskosten) Bei 0,15 € je Kilometer verteuert sich ... um ...: 1 kg
Bananen 1,4 Cent 1 Joghurt
0,5 Cent 1Paar
Schuhe 1-1,5 Cent 1Fernseher (€ 500) 19–21 Cent 1 Einbauküche (€10.000) 15,30 € Quelle: BMVBW |
Kilometer-, achs- und schadstoffabhängige Autobahngebühr (automatische Erhebung ohne Mauthäuschen) |
s.o. |
s.o. Eine
Verkehrsleistung von etwa 6 Mrd. Tonnenkilometer geht von der Straße auf die
Schiene. Ein
Plus von etwa 6,7 % auf der Schiene und ein Minus von etwa 2,1 % auf der
Straße. Quelle: BMVBW |
Schweiz: 0.72 DM/km |
|
|
|
PKW-Maut |
|
|
|
zeitlich und räumlich differenzierte Steuerung der Straßenraumnachfrage in staugefährdeten Bereichen (z.B. Ballungsräume) (Vgl. Telefontarife) |
Vermeidung von
Flüssigkeit des Verkehrs bei wachsender Mobilität Einstieg weg von der Steuer- hin zur Nutzerfinanzierung |
City-Maut: Verlagerung auf Rad/Fuß/ÖPNV |
Städtemaut:Tokio: 15 DM
pro Fahrt Oslo,
Bergen, Trondheim: 3 DM pro Einfahrt Singapur: mautpflichtige Straßen 0,30 DM – 2 DM je nach
Strecke, Fahrzeug und Uhrzeit (Laserabbuchung von Magnetkarte) Melbourne:
Innenstadt, sensorüberw.; Gebühren
geplant: Bristol, Edingburg, Kopenhagen, Göteborg, Genua,Rom (EU) >Autobahn-Gebühren |
||
|
(Gemeinden) |
seit 50er Jahren flächendeckend seit 80er Jahren |
|
Berlin: 2 DM/Std. bzw 4
DM/Std.; Köln: 10 DM/Std. Freiburg:
1-4 DM je nach Zentrumsnähe |
Bezahlung des genutzten Parkplatz, Anwohnerparkberechtigung (Vignette) |
Zeittarif bewirkt Verringerung der Zahl der Dauerparker
(Pendler) höherer PKW-Umschlag, Vergrößerung des Parkplatzangebots
|
1.Umsteigen auf ÖPNV (Dauerparker/Berufspendler) 2.weniger Parksuchverkehr und Falschparker 4. bessere Erreichbarkeit der Innenstadt 3. mehr PKW-Fahrten in Gebiete mit hoher Kurzzeitparknachfrage,
insgesamt aber Rückgang des MIV, dadurch Beschleunigung ÖV 5. ansprechende
Straßenraumgestaltung durch die Reduktion von Stellplätzen bewirkt Aufwertung
Innenstadt ggü peripheren EKZ. 6. je nach Preis/ Leistungsverhältnis (Attraktivität) veränderte Zielwahl (grüne Wiese) |
London: 3,50 DM/30 Min , 95 % Anteil des ÖPNV in die Innenstadt Wien: 1 DM/30 Min. kostenloses Kurzparken 10 Min.; Ergebnis:
Falschparker –86%, CO2: -4%; ÖPNV: + 6% Salzburg: Rad +73%., ÖPNV +16 %, PKW – 5% (Trend + 4%) - Auslastung: 85 >76% -
Reduktion d. Stellplätze um 25% (700), -
Parkdauer 169 >124 Min, - Umschlag
6> 8,5 Kfz - 50% aller abgestellten Fahrzeuge >Ausnahmegenehmigung. |
|
|
|
(Gemeinden) |
|
|
unterschiedlich je nach Grundstückkosten: 20.500 DM (Lübeck) 17.800 DM (Hamburg) |
Bauordnungen der Länder: Ablösegebühren anstelle der Errichtung notwendiger Stellplätze bei Neubauvorhaben. Preis: Æ Herstellungskosten und Grunderwerbskosten für 25 m² im Gemeindegebiet. Preiserlass bis zu 50 % bei besonderen Gründen möglich. Gem.-Satzung kann von Stell-platzpfl. und Ablöse befreien |
Ordnung, Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs, vermeiden von Parksuchverkehr, Falschparken |
|
|
|
|
|
Instrument |
Definition |
Kostenentlastung |
Ziel |
(Raum-)Wirkung |
Diskussion |
|
externe Kosten (bisher ungedeckt) |
Kostenentlastung durch Abwälzung von
Folgekosten (insb. Lärm, Schadstoffe, Flächenverbrauch (129 ha/Tag = 470 km²/a vgl. Berlin =
890 km²) nicht
gedeckte Unfallkosten) auf die Allgemeinheit. |
Die externen Kosten liegen bei einem PKW bei
durchschnittlicher Nutzung (1.000 km Fahrleistung und 88 Liter Benzin pro
Monat) mit Abgasnorm Euro 4 bei monatlich 280 DM , ohne Katalysator
bei monatlich 330 DM. Im Mittel verursacht ein PKW pro Jahr ca.4 500
DM externe Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden. Über die
Laufzeit des PKW gerechnet sind dies ca. 45 000 DM. Externe Gesundheitskosten der Schadstoffe aus dem
Verkehr (Deutschland): 28 Mrd. DM pro Jahr, 350 DM pro Einwohner und Jahr (UPI-Bericht 43), Todesfälle: > 25.000, 2
mal so viel wie durch Verkehrsunfälle; s. Gesundheitsschäden,
|
schrittweise Internalisierung externer Kosten
der Mobilität, am wirksamsten über die Mineralölsteuer |
Preisanstieg senkt Nachfrage
(Verbrauch): · geringere
Verkehrsleistungen des MIV · sinkender spez.
Energieverbrauch Veränderung des Modal split hin zu ÖPNV |
|
|
Instrument |
Begriffsbestimmung
|
Beispiel |
|
Firmenwagen |
Vom Arbeitgeber bereit gestellter Wagen für
Dienstfahrten: keine Versteuerung für Arbeitnehmer. Für die Strecke zwischen Wohung und
Arbeitsstätte: Steuerpflicht, da "Naturalbezug" des
Arbeitnehmers, der als Teil des Entgelts behandelt wird und somit auch der
Lohnsteuer unterliegt. Pro Monat ein Prozent des Brutto-Listenpreises plus
0,03 Prozent des Bruttolistenpreises je Entfernungskilometer. |
Listenpreis PKW bei Erstzulassung: 65.000 DM incl.
Extras und Umsatzsteuer. Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: 20
km. Der monatliche Vorteil berechnet sich wie folgt: 1. Geldwerter Vorteil für die Privatfahrten: 1 %
von 65.000 DM = 650 DM 2. Zuschlag für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte 0,03 % von
65.000 DM x 20 km (Entfernung) = 390 DM Total pro Monat lohnsteuerpflichtiger Vorteil von
1.040 DM, jährlich 12.480 DM |
|
ÖPNV-Tarife |
Kosten |
Regelung |
Beispiel |
Wirkung |
Fragen |
Diskussion |
|
Nulltarif |
|
freie
Fahrt mit öffentlichen Verkehsmitteln |
Hasselt
(Belgien) Templin
(Kurstadt in Brandenburg) Köthen
(Sachsen-Anhalt) |
Steigerung
der Fahrgastzahlen um das zehnfache, Reduzierung des PKW-Vekehrs |
nur
Verkehrsverlagerung oder auch Verkehrserzeugung? |
|
|
Bahncard |
270
DM/a (23-59J) 135
DM/a (17-23,>59J) 70 DM/a (Fam., <17J) |
Fahren
zum halben Preis bei DB AG in 2.
Klasse |
|
|
|
|
|
Berlinticket |
69
DM/a 35
€/a |
Fahrt
zum Ermäßigungstarif in Berlin (AB) (2,90
DM statt 4,20 DM) |
|
14.200 verkaufte Tickets |
|
|
|
Job-Ticket |
|
Rabatte
der Verkehrsgesellschaften für Großkunden, die eine bestimmte Anzahl von
Monats- und Jahreskarten abnehmen |
u.a.:
Kassel, Hamburg, Heidelberg, Karlsruhe, Rhein-Ruhr-Verkehrsverbund |
Veränderung
des Modal split: Umstieg von PKW auf ÖPNV |
|
|
|
Semester-Ticket |
|
Studiengebühr
schließt Semesterkarte für öffentlichen Nahverkehr mit ein |
Holland
(flächendeckend) Deutschland
(einzelne Regionen - http://www.his.de/soz15/pdf/19.Verkehr.pdf Bsp.
TU-Berlin (ABC): 426 DM/a |
Veränderung
des Modal split: Umstieg von PKW auf OPNV |
|
|
|
Schönes-Wochenende-Ticket |
40 DM |
bis
zu 5 Personen (bzw. Eltern mit beliebig vielen eigenen Kinden bis 17 Jahre),
ein Tag, (Samstag, Sonntag) für S-Bahn, RegionalBahn, RegionalExpress sowie InterRegioExpress, 2.
Klasse ohne Kilometerbegrenzung. |
Veränderung
des modal split im Freitzeitverkehr |
nur
Verkehrsverlagerung oder auch Verkehrserzeugung? |
|
|
|
Bundesländer-Ticket |
40
DM |
bis
zu 5 Personen (bzw. Eltern mit beliebig vielen eigenen Kinden bis 17 Jahre),
ein Wochentag, (i.d.R. ab 9.00-3.00 Uhr, an Wochenfeiertagen ganztägig) für S-Bahn, RegionalBahn,
RegionalExpress sowie InterRegioExpress, 2. Klasse ohne Kilometerbegrenzung
innerhalb best. Regionsgrenzen. |
Verbünde
bei Ländertickets: · Berlin-Brandenburg · Sachsen-Anhalt, Thüringen,
Sachsen; · Mecklenburg,
Schleswig-Holstein, HH; · Niedersachsen, Bremen,
Hamburg ·
Saarland, Rheinland-Pfalz ·
Bayern ·
Baden-Württemberg |
Veränderung
des modal split im Freitzeitverkehr |
|
|
|
Einheitstarif |
|
gesamter
Raum hat einen Tarif |
in
Stadtgebieten |
attraktiv,
einfach zu begreifen |
Kostengerechtigkeit:
Langstreckenfahrer weniger belastet als Kurzstreckenfahrer. Fördert
Einheitstarif Zersiedl.? |
|
|
Umweltkarte |
|
deutliche
Tarifsenkung bei Monats- und Jahreskarten (-30 %) zur Werbung neuer bzw.
Rückgewinnung verlorener Fahrgäste |
Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr Freiburg
|
Veränderung
des Modal split: Umstieg von PKW auf OPNV |
|
Umfrage
SenStadt: Umstieg
von Auto auf ÖPNV bei deutlicher Tarifsenkung? Ja:
61,7 % Nein:
38, 2 % (23.10.2001) |
|
Zeit-Zonentarif |
|
zeitlich:
30 Min. / 60 Min. |
|
|
|
|
|
Raum-Zonentf. |
|
räumlich:
gilt in best. Zone |
Verkehrsverbünde |
überfüllte
P+R-Plätze an T-Zonengrenzen |
|
|
|
Unternehmenstarif |
|
jedes
Verkehrsunternehmen hat eigenen Tarif, neuer Fahrschein erforderlich |
|
|
|
|
|
Schülerticket/ Geschwisterkarte |
45
DM (450 DM/a) 30
DM (300 DM/a) |
Monatskarte
für Berlin AB Monatskarte
Berlin AB |
|
|
|
|
|
Freizeitkarte |
45
DM |
übertragbare
Monatskarte für Wochenend-, Feiertags- und Feierabend-Verkehr (ab
18.30-3.00), ermäßigter Fahrpreis zu den übrigen Zeiten. |
Berlin
(BVG) |
Veränderung
des modal split im Freitzeitverkehr (5.500 verkaufte Karten) |
|
|
|
Instrument |
Regelung |
Beispiel |
Wirkung |
Diskussion |
|
Trassenpreise Bahn |
"Entherrschung" der Netz AG innerhalb der
Bahn-Holding bei Trassenvergabe und –preisfestsetzung: Unabhängigkeit,
Prozesskontrolle (Eisenbahnbundesamt), Transparenz (Bilanzpflicht) und
Wettbewerbskontrolle (Eisenbahnbundesamt, Kartellamt) Rede Bodewig |
Deutschland |
Wettbewerb auf der Schiene im Personen-
und Güterverkehr, sinkende Tarife und Trassenpreise, steigende
Verkehrsanteile der Schiene bei Personen und Gütern gegenüber Auto und
Flugzeug |
|
|
Landegebühren (Flughafenbetreiber) |
München: Die Landegebühr setzt sich aus mehreren
Komponenten zusammen: Höchstabfluggewicht des Flugzeuges, Triebwerkslärm,
Anzahl der Passagiere (Inland: 10,65 DM pro Passagier; Ausland: 13,60 DM) und
der Landezeit (Aufschlag zwischen nach 22.00 Uhr oder vor 6.00 Uhr). |
Landegebühren im Vergleich: Abhängig von Lärmemissionen
bei sonst gleichen Voraussetzungen (Abfluggewicht 59 Tonnen, 100 Passagiere): Boeing 737-200 (Kapitel-2): 4.000 DM Boeing 737-300 (Kapitel-3): 2.500 DM. Pro Passagier 15 DM mehr. |
Förderung lärmarmer Triebwerke
(Chapter3 – IATA) |
▲Befristete
und begrenzte Steuerbefreiungen für
Benzin-/Diesel-PKW in DM
|
|
Bis
zur Aufschöpfung folg. Höchstbeträge (DM) |
||
|
PKW-Emissionsgruppe |
Benzin/Diesel |
||
|
Erstzulassung |
bis
31.12.99 |
1.1.00
bis 31.12.04 |
1.1.05
bis 31.12.05 |
|
Euro 3 |
250 / 500 |
|
|
|
Euro 4 |
600 / 1.200 |
|
|
|
5-Liter-Auto |
500
/ 500 |
|
|
|
3-Liter-Auto |
1.000
/ 1.000 |
||
|
Euro 3 und
5-Liter-Auto |
750
/ 1.000 |
|
|
|
Euro 4 und
5-Liter-Auto |
1.100
/ 1.700 |
600
/ 1.200 |
|
|
Euro 3 und
3-Liter-Auto |
1.250
/ 1.500 |
1.000
/ 1.000 |
|
|
Euro 4 und
3-Liter-Auto |
1.600
/ 2.200 |
1.000
/ 1.000 |
|
Elektroautos: 5 Jahre steuerfrei, danach Besteuerung nach
Gewicht
Quelle: http://www.bayern.de/STMF/seiten/i_kfz/seiten/kfz1.pdf
▲Steuersätze seit 1960

▲ Änderung
des Treibstoffabsatzes

Quelle: http://www.upi-institut.de/energieverbrauch.htm
▲Benzinpreis und Verbrauch


▲Durchschnittliche KFZ-Ausgaben verschiedener Haushalte http://www.upi-institut.de/cdu-kamp.htm


1960 musste ein
Arbeitnehmer für einen Liter Benzin 13 Minuten arbeiten, heute dagegen nur 4
Minuten.
▲durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

▲CO2-Emissionen
(Mio. t/Jahr)

▲CO2-Emissionen in Deutschland – Anteil in Prozent

▲ Steuerlich
absetzbares Kilometergeld/Entfernungspauschale für Fahrten mit PKW zur
Arbeitsstätte
Seit 2001: 0-10 km = 70 Pfennig > 10 km = 80 Pfennig
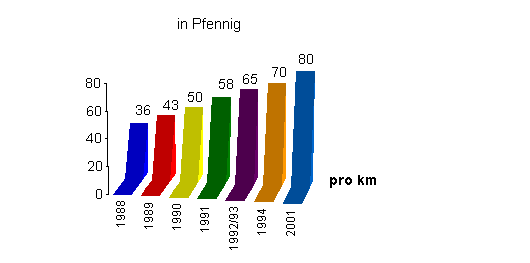

|
Jahr |
Treibstoff |
Strom |
Heizöl |
Erdgas |
Kohle |
Entlastung
R-VS |
|
|
1999, 1.
Stufe |
+6 Pf/l |
+2 Pf/kWh |
+4 Pf/l |
0,32 Pf/kwh |
0 |
-0,80 % |
|
|
2000 |
+6 Pf/l |
+0,5 Pf/kWh |
0 |
0 |
0 |
-0,10 % |
|
|
2001 |
+6 Pf/l |
+0,5 Pf/kWh |
0 |
0 |
0 |
-0,30 % |
|
|
2002 |
+6 Pf/l |
+0,5 Pf/kWh |
0 |
0 |
0 |
-0,30 % |
|
|
2003 |
+6 Pf/l |
+0,5 Pf/kWh |
0 |
0 |
0 |
-0,30 % |
|
|
Summe
1999-2003 |
+30 Pf/l |
+4 Pf/kwh |
+4 Pf/l |
+0,32 Pf/kwh |
0 |
-1,80 % |
Quelle: www.upi-institut.de/oes699.htm
▲Wie es anders geht, zeigt seit Jahren Großbritannien: Dort wird seit 1994,
noch beschlossen von der konservativen Regierung, jedes Jahr die
Mineralölsteuer automatisch um 6% über der Inflationsrate erhöht. Im laufenden
Haushaltsjahr wird die Steuer für Dieselkraftstoff zusätzlich zu den 6% erhöht,
insgesamt um sechs Pence (18 Pfennig) pro Liter. In England liegt die
Mineralölsteuer für Dieselkraftstoff inzwischen bei umgerechnet 1,74 Mark, mehr
als doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik Deutschland (74 Pfennig). Während
sich der Güterverkehr in Deutschland in den letzten Jahren massiv von der
Schiene auf die Straße verlagerte, wurde dieser Trend in England gestoppt und
umgekehrt: Im letzten Jahr lag die Zuwachsrate für den Schienentransport in
England bei 16 Prozent.
▲ Benzinpreise in Europa

▲ Dieselpreise in Europa

▲Tabelle: Öko-Steuern in Europa
|
Land |
Produkt |
Steuersatz |
Steuersatz Zukunft |
seit wann |
|
Dänemark |
umfassende Öko-Steuer-Reform |
Energie-, CO2-, Pestizid-, SO2-, Lösemittelsteuern u.a. |
|
1993 |
|
" |
z.B. Heizöl leicht |
15 Pf/l |
44 Pf/l in 2000 |
1993 |
|
" |
elektrischer Strom |
7 Pf/kWh |
14 Pf/kWh in 2000 |
1993 |
|
" |
CO2-Emissionen |
0,51 DM/t CO2 |
5,16 DM/t CO2 in 2000 |
1996 |
|
Belgien |
div. Einwegprodukte |
|
|
1993 |
|
Norwegen |
Getränkeeinwegverpackungen |
|
|
1994 |
|
Großbritannien |
Mineralölsteuer |
Erhöhung jedes Jahr um 6% über Inlationsrate |
jährliche Erhöhung 6% über Inlationsrate |
1994 |
|
" |
Müllabgaben, Deponiesteuer |
Erhöhung um 30% |
|
1998 |
|
Niederlande |
Erdgas |
3,4 Pf/m3 |
Anstieg auf 10 Pf/m3 bis 1998 |
1996 |
|
" |
Strom |
3,1 Pf/kWh |
|
1996 |
|
" |
Heizöl leicht |
2,8 Pf/l |
Anstieg auf 8,5 Pf/l bis 1998 |
1996 |
|
" |
Flüssiggas |
3,4 Pf/kg |
Anstieg auf 10 Pf/kg bis 1998 |
1996 |
|
" |
Planung einer Öko-Steuer-Reform |
u.a. Verdoppelung Energiesteuern, Verringerung Arbeitskosten |
|
1998 |
|
Finnland |
Getränkeeinwegdosen |
30 Pf/Getränkedose |
|
1996 |
|
Ungarn |
Einwegglasverpackungen |
21 DM/t Glas |
|
1996 |
|
" |
Kunststoffeinwegverpackungen |
108 DM/t Kunststoff |
|
1996 |
|
" |
Aluminiumeinwegverpackungen |
54 DM/t Aluminium |
|
1996 |
|
" |
Papiereinwegverpackungen |
31 DM/ Papier |
|
1996 |
|
Schweden |
CO2-Emissionen |
|
|
1991 al, Arial, Helvetica"> Tabelle 1: Öko-Steuern in Europa |
Quelle: http://www.upi-institut.de/oes.htm
▲
Beförderungsleistungen ÖV 1995 und 2000
|
|
Fahrgäste in Mio. |
mittlere Fahrtweite in km |
||
|
|
1995 |
2000 |
1995 |
2000 |
|
Eisenbahn Nahverkehr |
1 771,5 |
1 857,2 |
21,8 |
20,8 |
|
Fernverkehr |
149,3 |
144,4 |
243,0 |
248,4 |
|
Öffentlicher Personenstraßenverkehr (Linienverkehr) |
7 794,7 |
7 777,1 |
6,7 |
6,7 |
▲
Entfernung zur Arbeitsstätte
und benutztes Verkehrsmittel (einfacher Weg) in Prozent (gerundet) (Mikrozensus 2000, Stat. Bundesamt)
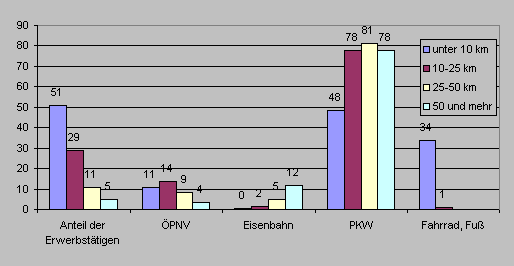
▲
Das bringt die
Entfernungspauschale
Entlastung ab
2001 im Vergleich zum geltenden Recht
|
|
Entfernung Wohnung-Arbeitsplatz |
||
|
Jahresbruttogehalt |
Beispiel 1: 15 km |
Beispiel 2: 25 km (Auto) 30 km (ÖPNV) |
|
|
40.000 DM |
ledig |
mit Auto 109 DM |
154 DM |
|
mit ÖPNV 328 DM |
1.014 DM |
||
|
|
verheiratet |
66 DM |
0 DM |
|
242 DM |
294 DM |
||
|
60.000 DM |
ledig |
114 DM |
186 DM |
|
396 DM |
1.210 DM |
||
|
|
verheiratet |
96 DM |
158 DM |
|
353 DM |
1.006 DM |
||
|
80.000 DM |
ledig |
133 DM |
218 DM |
|
465 DM |
1.443 DM |
||
|
|
verheiratet |
92 DM |
156 DM |
|
348 DM |
1.034 DM |
||
|
100.000 DM |
ledig |
152 DM |
251 DM |
|
533 DM |
1.656 DM |
||
|
|
verheiratet |
105 DM |
173 DM |
|
382 DM |
1.141 DM |
||
Quelle: BMF; dpa Graphik 3729
▲Bestand an Verkehrsmitteln
in Deutschland
|
|
Einheit |
1998 |
1999 |
2000 |
BMBau-Szenario
2015 |
Shell „OneWord“ 2020 |
Shell „Kaleidoskop“ 2020 |
|
Neuzulassungen von Pkw |
Anzahl |
3 736,0 |
3 802,2 |
3 378,3 |
|
|
|
|
Bestand an Verkehrsmitteln |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kraftfahrzeuge ¹ (Stand: 1.7.) |
Anzahl tsd. |
49 586,5 |
50 609,1 |
51 364,7 |
|
|
|
|
dar.: - PKW |
Anzahl tsd. |
41 673,8 |
42 323,7 |
42 839,9 |
49 816,0 |
52 000,0 |
47 800,0 |
|
- Lastkraftwagen |
Anzahl tsd. |
2 370,6 |
2 465,5 |
2 526,9 |
|
|
|
|
- Triebfahrzeuge ² |
Anzahl |
12 654 |
12 509 |
... |
|
|
|
|
- Reisezugwagen |
Anzahl |
15 544 |
15 333 |
... |
|
|
|
|
- Güterwagen (bahneigen) |
Anzahl |
139 744 |
132 396 |
... |
|
|
|
|
- eingestellte Güterwagen |
Anzahl |
61 523 |
59 322 |
... |
|
|
|
¹ 1993 Erfassungsstand im
Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR)
² Lokomotiven und Triebwagen
Quelle: Statistisches Bundesamt, www.statistik-bund.de/basis/d/verk/verktab2.htm
▲Erwiderung der Grünen zu den einzelnen "Argumenten"
der CDU:
- "Der
Staatsanteil am Benzinpreis liegt bei 70 %"
- "Null
Öko, die Ökosteuer hat keinerlei ökologische Wirkung."
- "Der
Öffentliche Nah- und Fernverkehr leidet unter der Ökologische Steuerreform."
- "Die
regenerativen Energieträger werden nicht von der Besteuerung
ausgenommen."
- "In
Frankreich und anderen Staaten wird die Mineralölsteuer gesenkt, in
Großbritannien die turnusmäßige Anhebung ausgesetzt."
"Der
Staatsanteil am Benzinpreis liegt bei 70 %".
– Richtig, verschwiegen wird aber, dass gegen
Ende der Kohlregierung der Staatsanteil sogar bei 80 % lag. 0,98 DM, d.h. 89 %
der jetzigen Mineralölsteuer von 1,10 DM gehen auf das Konto der alten
Regierung.
"Null Öko, die Ökosteuer hat keinerlei ökologische Wirkung." – Falsch, die Mineralölindustrie verzeichnet für das erste Halbjahr 2000 deutliche Absatzrückgänge für die Mineralölprodukte. Bei Autoherstellern und Verbrauchern ist ein erstes Umdenken in Richtung Energiesparen und höherer Energieeffizienz zu verzeichnen. Hinzu kommt die langfristige Anreizwirkung der Ökologischen Steuerreform zum sparsamen Umgang mit Energie. Die erste Frage beim Autohändler ist inzwischen immer häufiger die nach dem Verbrauch und nicht mehr nach der PS-Zahl.
"Der Öffentliche Nah- und Fernverkehr leidet unter der Ökologische Steuerreform." - In erster Linie soll die Ökologische Steuerreform durch die Erhöhung der Energiepreise den Energieverbrauch senken, auch im Verkehrsbereich. Dies betrifft sowohl den privaten als auch den öffentlichen Verkehr. In zweiter Linie geht es um die Verlagerung des Verkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel. Um diese Verlagerung zu beschleunigen, zahlt die Bahn nur den halben Satz der Stromsteuer und der ÖPNV nur die halben Ökosteuersätze bei der bei der Kraftstoffbesteuerung. Dadurch wird die relative Wettbewerbssituation von Bahn und ÖPNV gegenüber dem Individualverkehr nachdrücklich gestärkt.
"Die regenerativen Energieträger werden nicht von der Besteuerung ausgenommen." - Auf regenerative Energien wird tatsächlich - abgesehen von der Eigenerzeugung bis 2 MW - auch Stromsteuer erhoben. Dies liegt zur Zeit noch an EU-rechtlichen und erhebungstechnischen Problemen. Unser Ziel im Rahmen der Ökologischen Steuerreform ist nun, die Steuerbefreiung für erneuerbare Energien 2001 zu erreichen. Dazu muss ein rechtsfestes Zertifikatsmodell entwickelt werden, mit dem dann auch importierter "Grüner Strom" geprüft werden kann. Daran wird derzeit gearbeitet.
"In Frankreich und anderen Staaten wird die Mineralölsteuer gesenkt, in Großbritannien die turnusmäßige Anhebung ausgesetzt." -Frankreich hat zunächst als Reaktion auf die militanten Proteste eine Rückerstattung an den Güterverkehr in Höhe von insgesamt 60 Centimes (ca. 18 Pfennig) verkündet, verteilt auf 2000 und 2001. Am 20.9.2000 hat Finanzminister Fabius dann eine "konjunkturelle Senkung" der Mineralölsteuer um 20 Centimes (6 Pfennig) zum 1.10. angekündigt. Eine Bevorzugung nur des Güterverkehrs müsste von der EU-Kommission genehmigt werden, was keinesfalls sicher ist, da derartige Ausnahmen eigentlich nicht genehmigungsfähig sind. Die generelle Absenkung kann dagegen von der EU nicht verhindert werden, stößt aber auf einhellige Ablehnung aller anderen EU-Staaten. Unabhängig davon bleiben die französischen Spritpreise über den deutschen - von einer Besserstellung kann also keinesfalls die Rede sein. Ähnlich sieht es in anderen Nachbarländern aus. In Großbritannien hat der seit 1993 geltende ‚road fuel tax escalator' zu den EU-weit höchsten Spritpreisen geführt. Dieser wird nun vorübergehend ausgesetzt, seine Wiedereinsetzung ist aber keinesfalls ausgeschlossen.
Im
europäischen Vergleich der Spritpreise liegt Deutschland
(durchschnittlich 2,08 DM pro Liter EuroSuper)weiterhin im hinteren
Mittelfeld: In der EU auf Platz 9, in Europa auf Platz 12. Spitzenreiter
ist Großbritannien (2,69), vor Finnland (2,46), den Niederlanden (2,35),
Dänemark (2,29), Schweden (2,27) und Frankreich (2,19). (Stand: 14.09.00,
ADAC)
http://www.tigros-net.de/index.php3?go=gesetze vom
19.12.1952 (BGBl I S. 837) Stand: Anfang 1995 (6) Soweit das Parken auf öffentlichen Wegen und
Plätzen nur während des Laufs einer Parkuhr oder anderer Vorrichtungen oder
Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden Gebühren
erhoben; dies gilt nicht für die Überwachung der Parkzeit durch
Parkscheiben. Die Gebühren stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im
übrigen dem Träger der Straßenbaulast zu. Die Gebühren betragen je
angefangene halbe Stunde 0,10 DM. Es kann eine höhere Gebühr als 0,10 DM
festgesetzt werden, wenn und soweit dies nach den jeweiligen örtlichen
Verhältnissen erforderlich ist, um
die Gebühr dem Wert des Parkraums für den Benutzer angemessen anzupassen.
Die Nutzung des Parkraums durch eine möglichst große Anzahl von
Verkehrsteilnehmern ist zu gewährleisten. Bei der Gebührenfestsetzung
kann eine innerörtliche Staffelung vorgesehen werden. Für den Fall, daß
solche höheren Gebühren festgesetzt werden sollen, werden die
Landesregierungen ermächtigt, Gebührenordnungen zu erlassen. In diesen kann
auch ein Höchstsatz festgelegt werden. Die Ermächtigung kann durch
Rechtsverordnung weiter übertragen
werden.
Beispiel Schleswig-Holstein:
Landesverordnung über Parkgebühren Vom 12. April 1990, Gl.-Nr.: B9290-0-12, Fundstelle:
GVOBl. Schl.-H. 1990 S. 264 Aufgrund des § 6 a Abs. 6 Satz 10 und Abs. 7 des
Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Dezember
1952 (BGBl. I S. 837), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Januar 1987
(BGBl. I S. 486), verordnet die Landesregierung: § 1 Die der Landesregierung durch § 6 a Abs. 6 Satz 5 bis 8
und Abs. 7 des Straßenverkehrsgesetzes erteilte Ermächtigung,
Gebührenordnungen für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen sowie
auf gebührenpflichtigen, für Großveranstaltungen eingerichteten Parkplätzen
durch Verordnung zu erlassen, wird auf die Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden sowie die Amtsvorsteherinnen und
Amtsvorsteher als örtliche Ordnungsbehörden übertragen. § 2 Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über
Parkgebühren vom 13. Februar 1981 (GVOBl. Schl.-H. S. 50) außer Kraft. ▲
§ 6a ...
(7) Die Regelung des Absatzes 6 Satz 4 bis 10 ist auf die Erhebung von
Gebühren für die Benutzung gebührenpflichtiger Parkplätze im Sinne des § 6
Abs. 1 Nr. 13 entsprechend anzuwenden. (§ 6 Abs. 1: (1) Das
Bundesministerium für Verkehr wird ermächtigt, Rechtsverordnungen und
allgemeine Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des Bundesrates zu
erlassen über ... Nr. 13: die Einrichtung gebührenpflichtiger Parkplätze
bei Großveranstaltungen im Interesse der Ordnung und Sicherheit des
Verkehrs)
http://morgenpost.berlin1.de/archiv2001/010331/titel/story408058.html Berliner
Morgenpost 31.3.2001 ▲ Richter kippen Berliner Parkraumbewirtschaftung ker Berlin - Das Berliner
Verwaltungsgericht hat die Parkraumbewirtschaftung in der Hauptstadt
praktisch gekippt. In einem Beschluss bescheinigte es den Behörden, dass es
für die Einführung der kostenpflichtigen Zonen keine Rechtsgrundlage gibt.
Nach dem Spruch gilt die Parkraumbewirtschaftung im Bereich zwischen Berg-
und Albrechtstraße in Steglitz ab sofort nicht mehr. In der Begründung ließ
das Gericht keinen Zweifel daran, dass auch die übrigen Zonen in der
westlichen und östlichen Innenstadt jetzt auf dem Prüfstand stehen. Droht
dem Land jetzt eine Prozesslawine? Nach Auffassung der Richter gibt es für den Wunsch, den
Verkehr aus der Innenstadt fern zu halten, keine Grundlage in der Straßenverkehrsordnung (StVO). Die
Behörden hatten stets den Paragraphen
45 der StVO
als Grundlage für die Parkraumbewirtschaftung angegeben. Demnach dürfen
die Straßenverkehrsbehörden den Verkehr «aus Gründen der Sicherheit und
Ordnung» beschränken. Das Gericht entschied nun, dass das Parken in der
Innenstadt kein Angriff auf Sicherheit und Ordnung ist. «Eine hinreichende
Rechtsgrundlage für die Umsetzung der politisch gewollten
Parkraumbewirtschaftung fehlt», heißt es in dem Eilbeschluss weiter. Ein Ehepaar aus Steglitz hatte die Klage eingereicht.
Nach der Einrichtung einer Parkzone rund um die Schlossstraße bestehe in
ihrer Straße durch ausweichende Autofahrer eine unzumutbare
Umweltbelastung, hatte das Ehepaar argumentiert. Bei den zuständigen Ämtern zeigte man sich gestern
überrascht. Ralf Körner (CDU), Verkehrsstadtrat von Steglitz-Zehlendorf,
gab keine Stellungnahme zu dem spektakulären Beschluss ab. Körner will
zunächst die schriftliche Begründung abwarten. Auch in der Verkehrsverwaltung
herrschte Ratlosigkeit. Der Polizeipräsident kündigte indes an, Berufung
einzulegen zu wollen. Seit sechs Jahren gibt es in Berlin kostenpflichtige
öffentliche Parkplätze - neun Parkzonen in westlichen, fünf in östlichen
Bezirken http://www.kaufmannsgilde.de/gilde/Gilde2000/parken100.htm ▲ WEG MIT DEN PARKGEBÜHREN Wo
die Stadtväter das Parken verbilligen, steigen die Umsätze des Handels -
und auch die Gemeindekasse profitiert. Ein Erfahrungsbericht aus 17
Städten, die mit gutem Beispiel vorangehen. Parkplätze
zählen zu den wichtigsten Argumenten, wenn Kunden entscheiden, wo sie ihr
Geld ausgeben wollen, fand der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels
(HDE) heraus. PARKGEBÜHREN-PIONIERE Stadt Maßnahme Zeitpunkt Augsburg von
DM 3 auf DM 1 gesenkt 3-98 Bielefeld Samstag
4 P-Häuser bis 11:00, Parkplätze 2h frei 10-99 Brühl Gebühren
halbiert 12-98 Dachau Gebühren
abgeschafft (außer Parkhäuser) 11-98 Freilassing Die
ersten 2h frei, Samstag den ganzen Tag 10-99 Füssen 3h
frei bei DM 30,- Mindesteinkauf 6-99 Gelsenkirchen Halbierung
der Gebühren für die erste Stunde 11-96 Göttingen In
Parkhäusern von DM 3,- auf DM 2,- gesenkt 1-99 Hamm Erste
halbe Stunde frei 11-96 Hannover Ab
17:00 Uhr kostenfrei 11-98 Herford Erste
halbe Stunde in städtischen P-Häusern frei 12-98 Krefeld Halbierung
der Gebühr der ersten halben Stunde 10-98 Neumünster Halbierung
der Gebühren 10-97 Nürnberg Von
DM 5,- auf DM 3,- gesenkt 11-98 Oberhausen Ab
16:00 kostenfreies Parken 7-98 Viersen Samstag
kostenlos 10-98 Wesseling Gebühren
abgeschafft (außer Parkhäuser) 11-99
Doch nicht nur Händler profitieren. Auch für Stadtkämmerer lohnt es, über
die Höhe der Parkgebühren nachzudenken. Beispiel Krefeld. Die
Seidenmetropole halbierte die Parkgebühren für die ersten drei Stunden.
Erwartete Einnahmeausfälle der Stadt: eine Million Mark. Tatsächlich
betrug der Verlust nach zwölf Monaten nur 500000 Mark, da die Parkplätze
stärker genutzt werden. Auf dieser halben Million bleibt die Stadt nicht
sitzen. Denn mit höheren Umsätzen der Händler wächst das
Gewerbesteueraufkommen. Überschlägige impulse-Rechnung: geschätztes
Umsatzplus der rund 1200 betroffenen Betriebe zwei Prozent
gleich 26 Millionen Mark. Das ergibt (bei geschätzten 15 Prozent Gewinn
aus dem Mehrumsatz und 20 Prozent Gewerbesteuer) zusätzliche
Gewerbesteuer-Einnahmen von 780000 Mark. Der kundenfreundliche Dreh an
der Parkuhr hat sich für alle gelohnt. Also: Kämmerer, umdenken. Weg mit
den Parkgebühren.
http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo.html
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO):
vom
16. November 1970 (BGBl. I S. 1565, 1971 I S. 38), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 11. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1690), in Kraft getreten am 01.
Februar 2001.
▲§45 Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen
(1)
Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder
Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs
beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben
sie
1.
zur Durchführung von
Arbeiten im Straßenraum,
2.
zur Verhütung
außerordentlicher Schäden an der Straße,
3.
zum Schutz der
Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen,
4.
zum Schutz der Gewässer
und Heilquellen,
5.
hinsichtlich der zur
Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen sowie
6.
zur Erforschung des
Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe sowie zur
Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen.
(1a)
Das gleiche Recht haben sie ferner
1.
in Bade- und
heilklimatischen Kurorten,
2.
in Luftkurorten,
3.
in Erholungsorten von
besonderer Bedeutung,
4.
in Landschaftsgebieten
und Ortsteilen, die überwiegend der Erholung dienen,
a.
hinsichtlich örtlich
begrenzter Maßnahmen aus Gründen des Arten- oder Biotopschutzes,
b. hinsichtlich örtlich und zeitlich begrenzter Maßnahmen
zum Schutz kultureller Veranstaltungen, die außerhalb des Straßenraumes
stattfinden und durch den Straßenverkehr, insbesondere durch den von diesem
ausgehenden Lärm, erheblich beeinträchtigt werden,
5.
in der Nähe von
Krankenhäusern und Pflegeanstalten sowie
6.
in unmittelbarer Nähe
von Erholungsstätten außerhalb geschlossener Ortschaften,
wenn
dadurch anders nicht vermeidbare Belästigungen durch den Fahrzeugverkehr
verhütet werden können.
(1b)
Die Straßenverkehrsbehörden treffen auch die notwendigen Anordnungen
1.
im Zusammenhang mit der
Einrichtung von gebührenpflichtigen Parkplätzen für Großveranstaltungen,
2.
im Zusammenhang mit der
Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher
Gehbehinderung und Blinde sowie für Anwohner,
3.
zur Kennzeichnung von
Fußgängerbereichen und verkehrsberuhigten Bereichen,
4.
zur Erhaltung der
Sicherheit oder Ordnung in diesen Bereichen sowie
5.
zum Schutz der
Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder zur Unterstützung einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung.
Die
Straßenverkehrsbehörden ordnen die Parkmöglichkeiten für Anwohner, die
Kennzeichnung von Fußgängerbereichen, verkehrsberuhigten Bereichen und
Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder zur
Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Einvernehmen mit
der Gemeinde an.
(1c)
Die Straßenverkehrsbehörden ordnen ferner innerhalb geschlossener Ortschaften,
insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und
Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf, Tempo 30-Zonen im
Einvernehmen mit der Gemeinde an. Die Zonen-Anordnung darf sich weder auf
Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) noch auf
weitere Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) erstrecken. Sie darf nur Straßen ohne
Lichtzeichen geregelte Kreuzungen oder Einmündungen, Fahrstreifenbegrenzungen
(Zeichen 295), Leitlinien (Zeichen 340) und benutzungspflichtige Radwege
(Zeichen 237, 240, 241 oder Zeichen 295 in Verbindung mit Zeichen 237)
umfassen. An Kreuzungen und Einmündungen innerhalb der Zone muss grundsätzlich
die Vorfahrtregelung nach § 8 Abs. 1 Satz 1 ("rechts vor links")
gelten. Abweichend von Satz 3 bleiben vor dem 1. November angeordnete Tempo
30-Zonen mit Lichtzeichenanlagen zum Schutz der Fußgänger zulässig.
(1d)
In zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen und
überwiegender Aufenthaltsfunktion (verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche) können auch
Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen von weniger als 30 km/h angeordnet werden.
(1e)
Nach Maßgabe der auf Grund des § 40 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes von den
Landesregierungen erlassenen Rechtsverordnungen (Smog-Verordnungen) bestimmen
die Straßenverkehrsbehörden schließlich, wo und welche Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen bei Smog aufzustellen sind.
(2)
Zur Durchführung von Straßenbauarbeiten und zur Verhütung von außerordentlichen
Schäden an der Straße, die durch deren baulichen Zustand bedingt sind, können
die Straßenbaubehörden - vorbehaltlich anderer Maßnahmen der
Straßenverkehrsbehörden - Verkehrsverbote und -beschränkungen anordnen, den
Verkehr umleiten und ihn durch Markierungen und Leiteinrichtungen lenken.
Straßenbaubehörde im Sinne dieser Verordnung ist die Behörde, welche die
Aufgaben des beteiligten Trägers der Straßenbaulast nach den gesetzlichen
Vorschriften wahrnimmt. Für Bahnübergänge von Eisenbahnen des öffentlichen
Verkehrs können nur die Bahnunternehmen durch Blinklicht- oder
Lichtzeichenanlagen, durch rot-weiß gestreifte Schranken oder durch Aufstellung
des Andreaskreuzes ein bestimmtes Verhalten der Verkehrsteilnehmer
vorschreiben. Alle Gebote und Verbote sind durch Zeichen und
Verkehrseinrichtungen nach dieser Verordnung anzuordnen.
(3)
Im übrigen bestimmen die Straßenverkehrsbehörden, wo und welche Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen anzubringen und zu entfernen sind, bei
Straßennamensschildern nur darüber, wo diese so anzubringen sind, wie Zeichen
437 zeigt. Die Straßenbaubehörden bestimmen - vorbehaltlich anderer Anordnungen
der Straßenverkehrsbehörden - die Art der Anbringung und der Ausgestaltung, wie
Übergröße, Beleuchtung; ob Leitpfosten anzubringen sind, bestimmen sie allein.
Sie können auch - vorbehaltlich anderer Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörden -
Gefahrzeichen anbringen, wenn die Sicherheit des Verkehrs durch den Zustand der
Straße gefährdet wird.
(3a)
Die Straßenverkehrsbehörde erläßt die Anordnung zur Aufstellung der Zeichen 386
nur im Einvernehmen mit der obersten Straßenverkehrsbehörde des Landes oder der
von ihr dafür beauftragten Stelle. Die Zeichen werden durch die zuständige
Straßenbaubehörde aufgestellt.
(4)
Die genannten Behörden dürfen den Verkehr nur durch Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen regeln und lenken; in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2
Nr. 5 und des Absatzes 1 d jedoch auch durch Anordnungen, die durch Rundfunk,
Fernsehen, Tageszeitungen oder auf andere Weise bekanntgegeben werden, sofern
die Aufstellung von Verkehrszeichen und -einrichtungen nach den gegebenen
Umständen nicht möglich ist.
(5)
Zur Beschaffung, Anbringung, Unterhaltung und Entfernung der Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen und zu deren Betrieb einschließlich ihrer Beleuchtung
ist der Baulastträger verpflichtet, sonst der Eigentümer der Straße. Das gilt
auch für die von der Straßenverkehrsbehörde angeordnete Beleuchtung von
Fußgängerüberwegen. Werden Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen für eine
Veranstaltung nach § 29 Abs. 2 erforderlich, so kann die Straßenverkehrsbehörde
der Gemeinde, in der die Veranstaltung stattfindet, mit deren Einvernehmen die
Verpflichtung nach Satz 1 übertragen.
(6)
Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, müssen
die Unternehmer - die Bauunternehmer unter Vorlage eines Verkehrszeichenplans -
von der zuständigen Behörde Anordnungen nach Absatz 1 bis 3 darüber einholen,
wie ihre Arbeitsstellen abzusperren und zu kennzeichnen sind, ob und wie der
Verkehr, auch bei teilweiser Straßensperrung, zu beschränken, zu leiten und zu
regeln ist, ferner ob und wie sie gesperrte Straßen und Umleitungen zu
kennzeichnen haben. Sie haben diese Anordnungen zu befolgen und
Lichtzeichenanlagen zu bedienen.
(7)
Sind Straßen als Vorfahrtstraßen oder als Verkehrsumleitungen gekennzeichnet,
bedürfen Baumaßnahmen, durch welche die Fahrbahn eingeengt wird, der Zustimmung
der Straßenverkehrsbehörde; ausgenommen sind die laufende Straßenunterhaltung
sowie Notmaßnahmen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sich die Behörde nicht
innerhalb einer Woche nach Eingang des Antrags zu der Maßnahme geäußert hat.
(8)
Die Straßenverkehrsbehörden können innerhalb geschlossener Ortschaften die
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf bestimmten Straßen durch Zeichen 274
erhöhen. Außerhalb geschlossener Ortschaften können sie mit Zustimmung der
zuständigen obersten Landesbehörden die nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c
zulässige Höchstgeschwindigkeit durch Zeichen 274 auf 120 km/h anheben.
(9)
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies
aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Abgesehen von der
Anordnung von Tempo 30-Zonen nach Absatz 1c oder
Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen nach Absatz 1d dürfen insbesondere
Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs nur angeordnet werden, wenn
auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die
das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Absätzen
genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt. Gefahrzeichen dürfen nur dort
angebracht werden, wo es für die Sicherheit des Verkehrs unbedingt erforderlich
ist, weil auch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht oder nicht
rechtzeitig erkennen kann und auch nicht mit ihr rechnen muß.
Die
Wiedergabe erfolgt ohne Gewähr
▲ Internalisierung externer Kosten des Verkehrs (UPI-Bericht
21m,
www.upi-institut.de/upi21.htm)
Die
Studie untersucht 9 Möglichkeiten zur Internalisierung externer Kosten im
Verkehr. Sie kommt zum Ergebnis, daß die praktikabelste Methode die Erhebung
der externen Kosten über die Mineralölsteuer ist.
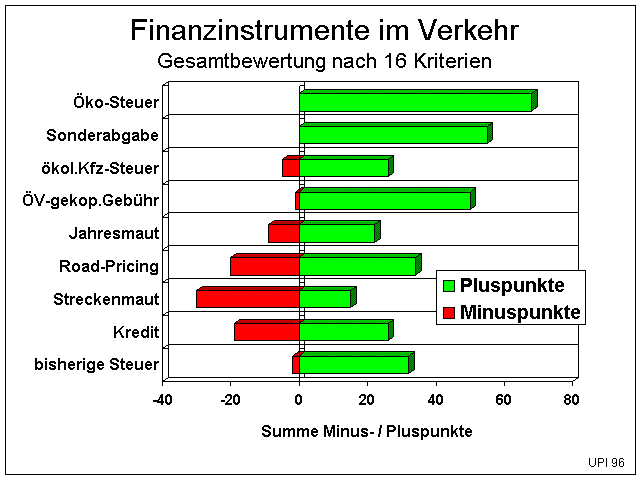
▲Tab. 2:
Gesundheitskosten durch verkehrsbedingte Luftverschmutzung
(Bundesrepublik Deutschland 1995) Werte in
Millionen DM/Jahr
|
Kategorie |
Indikator |
Mittelwert |
Minimum |
Maximum |
|
Produktionsausfälle |
Vorzeitige Todesfälle |
17 350 |
12 997 |
22 110 |
|
|
Invaliditätsfälle infolge chron.Bronchitis |
128 |
74 |
180 |
|
|
Spitalpflegetage |
5 |
3 |
7 |
|
|
Tage mit Arbeitsunfähigkeit |
3 617 |
3 338 |
3 930 |
|
Immaterielle Kosten |
Vorzeitige Todesfälle |
6 932 |
5 193 |
8 834 |
|
|
Invaliditätsfälle infolge chronischer Bronchitis |
16 |
9 |
23 |
|
|
Hospitalisationen |
9 |
6 |
11 |
|
Stationäre Behandlungskosten |
Spitalpflegetage |
16 |
10 |
21 |
|
Ambulante Behandlungskosten |
Fälle mit akuter Bronchitis |
24 |
13 |
38 |
|
|
Fälle mit chronischer Bronchitis |
147 |
85 |
207 |
|
|
Tage mit Asthmaattacken |
18 |
11 |
26 |
|
|
Tage mit Atemwegserkrankungen |
7 |
2 |
12 |
|
Administrativkosten von Versicherungen |
Zusätzliche med. Behandlungen |
3 |
2 |
3 |
|
|
Geringere Rentenleistungen |
-144 |
-108 |
-184 |
|
Summe |
|
28 129 |
21 636 |
35 218 |
Quelle: UPI-Bericht 43
http://staedtebund.wien.at/service/eckschlager_oegz0103.html
▲ERFAHRUNGEN AUS 10 JAHREN
PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG IN DER STADT SALZBURG
Dipl.-Ing. Martin Eckschlager (Magistrat der Stadt Salzburg, Abt. 9/00 -
Raumplanung und Verkehr)
Parkgebühren
in den Innenstädten: früher unvorstellbar, seit Anfang der 90er Jahre
unverzichtbar und heutzutage wieder heiß diskutiert. Kann mit dieser Maßnahme
nachhaltig ein Beitrag zur Lösung von Verkehrsproblemen der Stadtzentren
geleistet werden, oder ist sie nur eine verkehrsplanerische
"Modeerscheinung"? Anhand der vorliegenden Erfahrungen wird versucht,
diese komplexe Fragestellung zu beantworten.
1.
Einleitung
Salzburg gehört zu den meistbesuchten
Städten Europas. An Spitzentagen kommen cirka 50.000 Berufs- und
Ausbildungspendler, rund 60.000 Stadtbesucher aus dem Umland und etwa 30.000
Kurzzeittouristen in die 145.000 Einwohner zählende Stadt. Das heißt, dass sich
die Einwohnerzahl praktisch verdoppelt Die Autoströme konzentrieren sich im
Bereich Staatsbrücke, Makartplatz und Ferdinand-Hanusch-Platz – in einem
Stadtraum, der städtebaulich besonders reizvoll, aber aufgrund seiner
Straßenkonfiguration für den Autoverkehr nur bedingt geeignet ist. Denn hier
halten sich die Stadtbesucher auf, kommen ÖPNV-Fahrgäste an, steigen um und
fahren ab und drängeln die Reisebusse bzw. deren Fahrgäste zu einer oft auch
inoffiziellen Stadtrundfahrt.
Ende
der 80er Jahre stiegen die Behinderungen im Verkehr und die Belastungen durch
den Verkehr für Bewohner und Besucher unerträglich an. Es mussten kurzfristig
Verbesserungsmaßnahmen zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der inneren Stadt
erreicht werden. Die Stadtregierung beschloss deshalb ein Maßnahmenpaket.
Dieses enthielt in 2 Stufen folgende Maßnahmen:
Stufe 1 (Sofortmaßnahmen umzusetzen ab Mai 1990):
- Parkraumbewirtschaftung
- Reisebusleitsystem
- Park & Ride
- Tempo-30-Zonen
- Straßenraumgestaltung
- Busbeschleunigung
Stufe
2 (mittelfristige Maßnahmen; ab 1991 umzusetzen):
- neue Verkehrs- und Parkleitwegweisung
- neues Parkgebührenkonzept für Parkhäuser und
Parkgaragen
- Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung
- Fortsetzung von Busbeschleunigung und
Tempo-30-Zonen
- Staumanagement
- Sperrung hochbelasteter Innenstadtbereiche für
den Individualverkehr.
Während
Stufe 1 fast zur Gänze realisiert wurde, war dies bei Stufe 2 nur teilweise der
Fall.
Die
Parkraumbewirtschaftung, über die im Folgenden berichtet wird, war also Teil
eines Programms, das die neue Verkehrspolitik der Stadt Salzburg markieren
sollte.
2.
Parkraumbewirtschaftung im Zentrum
Parkgebühren sind ein gängiges
Mittel, den Dauerparker mit "sanftem Druck" zum Umsteigen auf
alternative Verkehrsmittel zu bewegen. Mittlerweile bleibt das
erfolgversprechende Rezept nicht mehr nur auf Groß- und Mittelstädte
beschränkt, sondern setzen auch kleinere Städte und Gemeinden, die unter
erheblichem Parkdruck leiden, vermehrt auf diese preispolitische Maßnahme.
In
der Stadt Salzburg war die Parkraumbewirtschaftung schon in den 70er Jahren im
Gespräch, wurde mit Inkrafttreten einer der ersten großflächigen Fußgängerzonen
im deutschsprachigen Raum dann erstmals versucht, scheiterte jedoch nach
wenigen Wochen an juristischen Problemen.
Im
Ziel- und Maßnahmenkonzept 1986 wurde die Parkraumbewirtschaftung neuerlich vom
Gemeinderat grundsätzlich beschlossen, jedoch erst ab 2.5.1990 – nachdem
Problembewusstsein und Druck aus der Bevölkerung erheblich angestiegen waren –
die erste ca. 1800 Stellplätze umfassende Phase verwirklicht. Vom breiten
politischen Willen getragen und auch von den Medien unterstützt, wurden die
Bewirtschaftungszonen in drei Schritten bis Ende 1992 auf die gesamte
Innenstadt und zum Teil darüber hinausgehend erweitert. Betroffen davon waren
etwa 5800 Stellplätze im öffentlichen Straßenraum (sämtliche Stellplätze in
Kurzparkzonen, Ladezonen, Parkverboten und Behindertenstellplätze).
Gleichzeitig
mit Einführung von Phase I erfolgte im Sinne von "Push and Pull" (also
der Umsetzung restriktiver, in erster Linie den mIV [motorisierten
Individualverkehr] treffende Maßnahmen bei gleichzeitiger
Attraktivitätssteigerung der Alternativen) eine Reduktion vorhandener
PKW-Stellplätze um ca. 25% (rund 700). Die freiwerdenden Stellplätze im
öffentlichen Straßenraum wurden zu Gunsten von Busspuren, Radwegen
und Grüngestaltung verwendet.
Ab Juli 1992 kamen weitere Teile am Rande der Innenstadt, der gesamte Bahnhofsbereich und die nördliche Altstadt hinzu. Die zweite großflächige Ausdehnung der Bewirtschaftungsgebiete wurde am 1.11.1992 realisiert und umfasste die Vorstadtbereiche Riedenburg, Nonntal, Äußerer Stein und ein Teilstück in Schallmoos (weitere Reduktion um 625 Stellplätze).
In den darauffolgenden Jahren erfolgte eine Vereinheitlichung
der maximal zulässigen Kurzparkdauer auf generell drei Stunden. Gleichzeitig
wurde die Bewirtschaftungszeit von Montag bis Freitag auf 9 bis 19 Uhr und am
Samstag von 9 bis 13 Uhr abgeändert (bis dahin Montag bis Freitag von 8 bis 18
Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr).
Ergebnisse Erfolgskontrolle Phase I
Die Erhebungen des Verkehrsaufkommens
zur ersten Stufe der Parkraumbewirtschaftung zeigten eine im Sinne des
verkehrspolitischen Ziel- und Maßnahmenkonzeptes positive Entwicklung:
Einer starken Zunahme des Radverkehrs und des ÖV (73
bzw. bis zu 16,5%) standen leichte Abnahmen des Kfz-Verkehrs im Bereich der
Parkraumbewirtschaftung gegenüber. Die Zahl der Fußgängerwege stagnierte. Die
Zunahmen im ÖV lagen unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung über
dem langjährigen Trend und waren höher als in anderen, vergleichbaren
Ballungsräumen. Insbesondere die Lokalbahn, ein regionales
Schienenverkehrsmittel, hatte überdurchschnittliche Zuwächse zu verzeichnen.
Ein merkbarer Einfluss der Parkraumbewirtschaftung auf die positive Entwicklung
des ÖV war jedenfalls anzunehmen.
Der Pkw-Verkehr nahm demgegenüber im bewirtschafteten
Gebiet um über 5% ab und dies vor dem Hintergrund allgemeiner Verkehrszunahmen.
Außerhalb der bewirtschafteten Zonen war die Entwicklung des Kfz-Verkehrs
unbeeinflusst von der Parkraumbewirtschaftung. Die durchschnittliche Zunahme
von 4% lag im österreichweiten Trend.
Von Interesse ist weiters, dass entgegen den
ursprünglichen Prognosen keine Zunahme der Garagenparker beobachtet werden
konnte. Nach den Statistiken der Garagenbetreiber sind sogar Frequenzrückgänge
eingetreten. Zugenommen hatte lediglich die Anzahl der Dauerkartenbesitzer, so
dass die Kapazität für Dauerparker an einigen Standorten erschöpft war. Kurzparker
wichen auf das jetzt leichter verfügbare und kostengünstigere Kurzparkangebot
an der Oberfläche aus.
Innerhalb der Bewirtschaftungsgebiete
- sank die durchschnittliche Auslastung der
Parkplätze von 85 auf 76%,
- sank die durchschnittliche Parkdauer von 169 auf
124 Minuten,
- stieg der Umschlag von 6 auf 8,5 Kfz-Fahrten je
Stellplatz und
- besaßen 50% aller abgestellten Fahrzeuge eine
Ausnahmegenehmigung.
Die Umschlagserhöhung führte in Gebieten mit hoher
Kurzparknachfrage trotz Stellplatzreduktion zu mehr Kfz-Verkehr.
Gesamt gesehen bewirkte die Bewirtschaftung einen leichten Rückgang der
Kfz-Fahrten zu den Parkplätzen. Durch die geringere Auslastung wurde die
Parkplatzsuche erleichtert. In den an die Bewirtschaftungszonen angrenzenden
Bereichen stieg die Auslastung der Parkplätze durch Dauerparker, nahm die
durchschnittliche Parkdauer zu und stiegen zum Teil auch die Kfz-Fahrten.
Besonders Berufspendler wichen in die angrenzenden Bereiche aus.
Zusammenfassend ließ sich feststellen, dass die
Änderung im Verkehrsverhalten auch auf die Parkraumbewirtschaftung
zurückgeführt werden konnte. Die hohen Zunahmen beim Radverkehr und
öffentlichen Verkehr sind aber Resultat des Zusammenwirkens mehrerer Maßnahmen
bzw. dem eingangs angeführten Maßnahmenbündel. (Koch, 1991)
Ergebnisse Erfolgskontrolle Phase II
Der positive Trend in der
Verkehrsmittelwahl hat sich entsprechend den Ergebnissen der Untersuchung zu
Phase II der Parkraumbewirtschaftung weiter fortgesetzt: So konnte im Oktober
1993 eine weitere Steigerung der Fahrgäste von Lokalbahn und Regionalbussen
erhoben werden. Die Anzahl der Radfahrer nahm gegenüber 1990 um über 100% zu.
Im Fußgängerverkehr waren weiterhin leichte Abnahmen zu erkennen und beim
öffentlichen, städtischen Obus wurden geringe Zunahmen festgestellt. Die
Frequenzentwicklung in den kommerziellen Garagen zeigte eine Stagnation bzw.
weitere leichte Abnahmen bei den Einzelkunden. Ausschlaggebend dafür dürfte der
hohe Preisunterschied zwischen den Gebühren in öffentlichen Garagen und
denjenigen in bewirtschafteten Kurzparkzonen sein. (siehe Abb. 1)
Als wesentliche Erfolge des bis dahin vor allem in
Wirtschaftskreisen kontrovers diskutierten Planungsinstrumentes
Parkraumbewirtschaftung ergaben sich
- weniger Staus und Erleichterung bei der Parkplatzsuche,
- damit eine Verbesserung der Erreichbarkeit
der gesamten Innenstadt,
- eine Reduktion des nicht notwendigen
Kfz-Verkehrs und hier vor allem des Berufspendlerverkehrs,
- die Verbesserung der Situation der Anrainer in
den bewirtschafteten Zonen infolge
- Freihaltung der Wohngebiete von gebietsfremden
Parkern bei gleichzeitiger Erleichterung der Parkplatzsuche und der
Erteilung von Ausnahmenbewilligungen,
- eine Beschleunigung des ÖV durch die Abnahme des übrigen Kfz-Verkehrs im übrigen Innenstadtbereich und
- mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und für eine ansprechende
Straßenraumgestaltung, die durch die Reduktion ursprünglich
vorhandener Parkflächen ermöglicht wurde und damit insgesamt eine Aufwertung
des innerstädtischen Wirtschaftsstandortes gegenüber den peripheren EKZ.
(Koch, Wiesinger, 1994)
Diese Erfolge sind umso bemerkenswerter, als von der
Parkraumbewirtschaftung – wie die untenstehende Abbildung zeigt – nur 21%
der insgesamt vorhandenen Stellplätze erfasst werden. (Öffentliche und
private Stellplätze siehe Abb. 2.)
3. Parkreglementierungen in zentrumsfernen Stadtteilen
Aufgrund verschiedener
Verdrängungseffekte von den bewirtschafteten Zonen in die Umgebungsbereiche
konnten Probleme mit den dortigen Anrainern nicht ausbleiben.
Auslastungsprobleme zeigten vor allem Wohnquartiere im
Umgebungsbereich publikumsintensiver Einrichtungen, wie Krankenhäusern und
Behörden, sowie die Randzonen gebührenpflichtiger Bewirtschaftungsgebiete.
Detaillierte Ergebnisse einer fast das gesamte Stadtgebiet umfassenden
Parkraumuntersuchung erlaubten die Abgrenzung vordringlich zu bewirtschaftender
Zonen, aber auch solcher Bereiche, in denen eine Reglementierung des Parkens
dringend erforderlich, jedoch das Instrument gebührenpflichtigen Parkens nicht
als das geeignete erschien. Besonders problematisch gestaltete sich die
Situation in denjenigen Wohnquartieren, die noch in Zeiten geringer
Automotorisierung bzw. niedriger Stellplatzvorschreibungen errichtet wurden.
Geeignetes Rechtsinstrumentarium gegen Ausweichparker
in den Randzonen fehlt
Erschwerend wirkt sich bei der Suche
nach geeigneten Lösungen nach wie vor die rechtlich unbefriedigende Situation
aus: So ist derzeit eine Bewohnerbevorzugung für das Parken im öffentlichen
Straßenraum ausschließlich über das Instrument der Kurzparkzone möglich. Die
Anfang der 90er Jahre mögliche Ausweisung sogenannter Grüner Zonen (Zonen
mit Bewohnerbevorrechtigung) wurden bekanntlich aus verfassungsrechtlichen
Gründen aufgehoben.
Weiters engen die Vorgaben des Landesgesetzgebers den
Planungsspielraum ein, da bis dato keine Ausdehnung der Parkzeit über drei
Stunden zulässig ist und auch das Thema Pauschalierung (pauschal im Vorhinein
zu entrichtende Parkgebühr für bestimmte Nutzergruppen und daraus resultierend
wesentlich vereinfachtes Handling) aufgrund verschiedener politischer Bedenken
bis heute nicht gelöst wurde. Ergänzend sei hier erwähnt, dass kurioserweise
der Landesgesetzgeber für alle übrigen Salzburger Gemeinden bereits eine
entsprechende Regelung vorsieht.
Einführung großflächiger gebührenfreier Kurzparkzonen
zur Entlastung der Wohngebiete
Die Dringlichkeit kurzfristig
Verbesserungsmaßnahmen vorzuschlagen sowie die positiven Erfahrungen aus Phase
I und II veranlassten den für die Planung befassten Ressortpolitiker zur
Vorlage eines Amtsberichtes. Dieser wurde im Juli 1997 beschlossen und enthielt
als Sofortmaßnahme ein Pilotprojekt zur Einführung großflächiger,
gebührenfreier Kurzparkzonen im dichtest besiedelten Stadtteil Lehen (ca. 660
gebührenfreie Stellplätze). Gebührenfrei deshalb, da einerseits für die
Aufstellung von Parkscheinautomaten nur beschränkt Mittel zur Verfügung standen
und andererseits aufgrund der stadträumlichen Lage (reine Wohnviertel) im Falle
einer Bewirtschaftung nur geringe Einnahmen aus Parkgebühren zu erwarten waren.
Da die Stadtpolitik massiv auf eine entsprechende
Kontrolle der neuen gebührenfreien Zonen drängte, wurde von Seiten der
Bundespolizei zumindest für die Einführungsphase eine entsprechende Kontrolle
zugesagt. In den zentralen Bereichen Lehens beiderseits der Hauptgeschäftsmeile
Ignaz-Harrer-Straße wurde gleichzeitig mit den umgebenden gebührenfreien
Kurzparkzonen gebührenpflichtiges Kurzparken eingeführt.
Vorgelagert erfolgte über Drängen der dortigen
Kaufmannschaft im Stadtteil Maxglan entlang der Maxglaner-Hauptstraße die
Verordnung von ca. 100 gebührenfreien Kurzparkplätzen (Einführungstermin
1.10.1997).
Als nächster Schritt wurden in den Randzonen der
Bewirtschaftungsgebiete im Bereich Aiglhof/Maxglan bzw. im Verdrängungsbereich
der Landeskrankenanstalten großflächig gebührenfreie Kurzparkzonen eingeführt
(ca. 550 Stellplätze).
Aufgrund der nach relativ kurzer Zeit nachlassenden
Überwachungsintensität der Polizeiorgane sind jedoch die in der
Einführungsphase positiven Effekte innerhalb der gebührenfreien Kurzparkzonen
zunehmend verflacht. Trotzdem kann gegenüber der ursprünglichen Situation noch
immer eine Verbesserung festgestellt werden. Offensichtlich wirken sich die
negativen Erfahrungen einzelner Parksünder in den konsequent von privaten
Wacheorganen kontrollierten gebührenpflichtigen Zonen positiv auf die
allgemeine "Parkmoral" aus.
In diesem Zusammenhang soll auch der
Gemeinderatsbeschluss zur Stellplatzverordnung 1998 nicht unerwähnt bleiben.
Damit wurde die ursprüngliche, vor allem im Altstadtbereich oft undurchführbare
Vorschrift zur Errichtung von Parkplätzen bei Neu- und Umbau von Gebäuden durch
eine zeitgemäße, in erster Linie auf dem Grad der ÖV-Erschließung basierende Stellplatzvorschreibung
ersetzt (ÖGZ Nr. 3/99).
4. Zielsetzung für eine Neukonzeption
Das Oberziel für eine Neukonzeption
der Parkraumbewirtschaftung stellt die Anpassung des verkehrsplanerisch
effizienten Instrumentes an die seit Einführung im Jahre 1990 geänderten
Ansprüche und Anforderungen dar. Dies soll durch die Umsetzung einer
kundenorientierten Regelung des gesamten ruhenden Verkehrs innerhalb der
bestehenden Bewirtschaftungszonen und auch in den bekannten Problembereichen
außerhalb derselben erfolgen. Als Kunden werden Bewohner, Besucher und sonstige
auf öffentliche Parkplätze angewiesene Nutzergruppen verstanden.
Entsprechend dem am 7.5.1997 im Gemeinderat
beschlossenen neuen Verkehrsleitbild der Stadt Salzburg ist "… ausreichend
Parkraum bereitzustellen für die Wohnbevölkerung am Wohnort, Behinderte, den
Wirtschaftsverkehr und ArbeitnehmerInnen ohne zumutbare sonstige
Alternativen".
Eine funktionierende private Überwachung als
wesentliches Standbein der Neukonzeption
Im Februar 2000 wurde zur Verbesserung der Überwachung des ruhenden Verkehrs
der Einsatz privater Wachorgane auch außerhalb gebührenpflichtiger
Kurzparkzonen beschlossen. Ab April wurde in einem sechsmonatigen Zeitraum
deren Effizienz untersucht, wobei schwerpunktmäßig die verkehrsberuhigten
Innenstadtbereiche kontrolliert wurden. Aufgrund des vorgelegten durchwegs
positiven Erfahrungsberichtes wurde der Probebetrieb bis zur endgültigen
Klärung noch offener Vertragspunkte mit der Bundespolizei bis Ende 2001
verlängert.
Mit dem definitive Einsatz privater Überwachungsorgane
würde dem von Seiten der Verkehrsplanung wiederholt vorgebrachten Wunsch nach
Intensivierung der Überwachung des ruhenden Verkehrs Rechnung getragen. Bisher
wurde mangels geeigneter Alternativen, als Reaktion auf die schlechte Kontrolle
gebührenfreier Kurzparkzonen durch die Bundespolizei, z.B. auch in reinen
Wohngebieten, gebührenpflichtiges Kurzparken eingeführt. Damit konnte eine
effiziente Überwachung durch private Wacheorgane sichergestellt werden.
Aus finanzieller Sicht erwiesen sich derartige
Kurzparkzonen jedoch meist belastend für die Stadtgemeinde, da den hohen Kosten
für Parkscheinautomaten und Kontrolle nur geringe Einnahmen gegenüberstehen. Da
die Erteilung von Ausnahmebewilligungen für Bewohner, Arbeitnehmer und Betriebe
(§ 45 Abs. 2 und 4 StVO 1960) ausschließlich innerhalb von Kurzparkzonen
möglich ist, wird zur Vermeidung von Benachteiligungen für diese Nutzergruppen
in verschiedenen Stadtbereichen auch in Hinkunft der Bedarf nach gebührenfreien
Kurzparkzonen bestehen. Jedenfalls erlaubte der Einsatz
privater Überwachungsorgane auch außerhalb gebührenpflichtiger Kurzparkzonen,
bestehende gebührenpflichtige Kurzparkzonen, die ausschließlich aus den
angeführten Gründen eingerichtet wurden, zurückzunehmen und in gebührenfreie
umzuwandeln.
Zielsystem Parkraumbewirtschaftung 2002
Von der städtischen Verkehrsplanung
wurde ein Bericht ausgearbeitet, der die Weichen in Richtung
Parkraumbewirtschaftung 2002 stellen soll. Auch das Tabuthema einer Anpassung
der Parktarife in öffentlichen Kurzparkzonen an die üblichen Tarifsteigerungen
wurde neuerlich aufgegriffen. Rein objektiv gesehen wäre angesichts der
allgemeinen Entwicklung von Gebühren und Pro-Kopf-Einkommen eine Erhöhung schon
längst überfällig. Realistischerweise erscheint jedoch angesichts der "Gratis-Parkplatz
Werbestrategie" der Stadtrand-EKZ und dem daraus resultierenden Druck
der Innenstadtkaufleute auf die Stadtpolitiker diese verkehrspolitisch
sinnvolle Maßnahme nur schwer umsetzbar.
Da bekanntlich am 1.1.2002 innerhalb der 12 Staaten die an der Währungsunion teilnehmen, der EURO als Zahlungsmittel eingeführt wird, ist eine Umstellung oder ein Austausch der bis zu 12 Jahre alten, mittlerweile auch technisch überholten Parkscheinautomaten erforderlich. Bis zu diesem Stichtag sollen folgende, aus verkehrsplanerischer Sicht zweckmäßige Umstellungen und Adaptierungen realisiert werden:
- Gebührenpflichtiges Kurzparken nur mehr in denjenigen Bereichen, die eine erhöhte
Parkraumnachfrage verschiedener Nutzergruppen aufweisen.
- Innerhalb der gebührenpflichtigen Parkzonen soll eine Staffelung der Parkgebühren anhand der Parameter: Lagegunst, Stellplatzangebot und -tarife in den benachbarten öffentlichen Parkgaragen und Parkplätzen, Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum und Attraktivität bzw. Verfügbarkeit des ÖPNV erfolgen.
- Einführung gebührenfreier Kurzparkzonen in
Bereichen, die durch Verdrängungsparker aus den
bewirtschafteten Zonen einen Parkraummangel für Bewohner aufweisen bzw.
Umwandlung bestehender gebührenpflichtiger Parkzonen in gebührenfreie.
- Einsatz privater Wachorgane für die Überwachung
des gesamten ruhenden Verkehrs in den verkehrsberuhigten Bereichen, den
gebührenpflichtigen und gebührenfreien Kurzparkzonen.
- Anschaffung moderner Parkscheinautomaten, die auch die Verwendung bargeldloser Zahlungsmittel erlauben.
- Übersichtliche, einfach begreifbare und damit kundenorientierte Abgrenzung der verschiedenen Zonen (inklusive Bereinigung Schilderwald).
- Schrittweise Einführung marktgerechter Gebühren
für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen, die zumindest die
verwaltungsinternen Kosten abdecken.
- Verbreitung einer detaillierten, den gesamten
ruhenden Verkehr umfassenden Information über die neuen Medien (u.a.
Internet-Auftritt).
- Klare Deklaration der Verwendung von Einnahmen
aus Park- und Strafgebühren zur Akzeptanzerhöhung der
Parkraumbewirtschaftung.
- Verwaltungsinterne Neuorganisation, die
Synergieeffekte nützt und im Sinne der Verwaltungsökonomie eine
bestmögliche Lösung darstellt. Dies soll durch Zusammenführung der
gegenwärtig auf verschiedene Ämter verteilten Agenden des Produktes
Parkraumbewirtschaftung erfolgen.
Inwieweit vor dem Hintergrund allgemein abnehmenden Problembewusstseins
gegenüber den Auswirkungen eines überbordenden mIV die notwendigen Beschlüsse
erfolgen, werden die nächsten Monate zeigen. Der erst kürzlich vom Gemeinderat
beschlossene gebührenfreie Samstag lässt diesbezüglich Zweifel aufkommen.
Zusammenfassung
Die Parkraumbewirtschaftung ist
mittlerweile als preispolitische Maßnahme ein unverzichtbares Instrument zur
Verkehrsverlagerung in stark nachgefragten Parkbereichen. Einschlägige
Erfahrungen am Beispiel der Stadt Salzburg zeigen jedoch, dass eine genaue Differenzierung
nach Lage der Bewirtschaftungsgebiete zum Stadtzentrum, Benutzergruppen und
Angebot benachbarten, öffentlichen und privaten Parkraumes sowie der Parkdauer
notwendig ist. Von der Bewirtschaftung öffentlicher Stellplätze profitieren
in erster Linie Kunden und Bewohner, da vor allem dauerparkende Pendler
derartige Bereiche meiden.
Für die Umsetzung eines adäquaten Parkraumkonzeptes sind geeignete rechtliche Instrumentarien erforderlich, mit deren Hilfe flexibel auf spezifische kommunale Situationen reagiert werden kann. Ohne konsequente Überwachung bleibt auch bei dieser Maßnahme der erwartete Erfolg aus.
Aus Akzeptanzgründen soll die Parkraumbewirtschaftung
nach dem "Zuckerbrot und Peitsche-Prinzip" in ein Maßnahmenbündel
eingebettet sein, das auch gleichzeitig spürbare Verbesserungen bei den
möglichen Alternativen zum eigenen Pkw vorsieht. Beilage (Kenngrößen Parkraumberwirtschaftung)
VCD-Positionspapier
▲ Argumente zur Schwerverkehrsabgabe (LSVA)
Für eine faire Kostenverteilung im
Güterverkehr
1. Wohin fährt der Güterverkehr?
2. Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) - Forderungen
des VCD
3. Gute Gründe für eine LSVA
4. Einwände gegen die LSVA - und warum wir sie trotzdem
brauchen
5. Die technische Umsetzung - kein Problem
6. Was bringt die LSVA Bevölkerung, Umwelt,
Verkehrsunternehmen und Wirtschaft?
7. Die LSVA - längst überfällig
8. Breite Unterstützung für die LSVA
Vorwort:
Der Lkw-Verkehr hat die Grenzen der Belastbarkeit für Mensch und Umwelt längst überschritten. Die Zahl der transportierten Güter steigt und damit auch die Zahl der Lastkraftwagen, die täglich auf deutschen Straßen unterwegs sind.
Obwohl Lkw nur ein Zehntel der insgesamt in Deutschland gefahrenen Kilometer zurücklegen, stoßen sie mehr Stickoxide und krebserregende Rußpartikel aus als die gesamte Pkw-Flotte. Durch ihre hohe Achslast zerstören sie die Straßen und verursachen hohe Reparaturkosten, für die die Gesellschaft einstehen muss.
Die Lkw-Lawine ist das Ergebnis einer verfehlten Verkehrspolitik. Während in den letzten 50 Jahren das Straßennetz stetig ausgebaut wurde, wurde das Bahnnetz aus Mangel an Geld und verkehrspolitischem Interesse vernachlässigt und teilweise stillgelegt. Zudem wird der Warentransport auf der Straße durch niedrige Sozialstandards immer billiger, während der Schienengüterverkehr im Verhältnis zur erbrachten Qualität und Geschwindigkeit immer noch zu teuer ist. Die Folge: Immer weniger Güter werden mit der umweltfreundlicheren Bahn transportiert. Aufgabe der Politik ist es, den Wettbewerbsverzerrungen im Verkehrssektor entgegenzusteuern, um Mensch und Umwelt vor Lärm und Schäden zu schützen. Die entstandenen Kosten sind dem Verursacher anzulasten.
Daher fordert der Verkehrsclub Deutschland (VCD) bereits seit 1986 die Einführung einer europaweiten, leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) nach dem Verursacherprinzip.
Die Bundesregierung hat die Vorzüge einer solchen Abgabe erkannt und plant, sie bis Ende des Jahres 2002 in Deutschland einzuführen. Sie hat sich bisher noch nicht über die Höhe oder die konkrete Ausgestaltung der Abgabe geäußert. Diese sind jedoch entscheidend für die Wirksamkeit der Abgabe.
Der VCD möchte mit dieser Broschüre Antworten auf verschiedene Fragen zur leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe geben und konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung machen. Er zeigt Ziele sowie Vorteile auf und erörtert Konsequenzen einer solchen Abgabe.
s
1. Wohin fährt der Güterverkehr?
Während Gleisanschlüsse stillgelegt oder Gewerbegebiete gleich ohne Schienenanschluss geplant werden, führt das dicht ausgebaute Autobahnnetz in Deutschland, die Öffnung der EU-Grenzen und die Deregulierung im Verkehrsbereich zu sinkenden Lkw-Transportkosten und lässt den Straßengüterverkehr weiter ansteigen. Die differenzierte internationale Arbeitsteilung, die Zunahme der internationalen Wirtschaftsverflechtungen und die stärkere Spezialisierung führen zu veränderten Produktionsabläufen, die kleinere Transportmengen und den Wunsch nach mehr Flexibilität des Transportes fördern. Der Trend geht zu Just-in-time-Lieferungen und einer größeren Nachfrage nach hochwertigen Produkten. Diese Entwicklungen haben in der Vergangenheit den Lkw gegenüber der Bahn begünstigt.
Vor allem die Zahl der ausländischen Lkw ist in den letzten Jahren durch diese Entwicklungen enorm gestiegen. Sie benutzen das deutsche Straßennetz, werden aber - wie auch inländische Lkw - kaum an den durch sie verursachten Kosten beteiligt. 1997 wurden 26 Prozent der Straßengüter mit ausländischen Lkw befördert. Deutschland ist in den letzten Jahren zum Lkw-Transportland Nummer eins in Europa avanciert.
Immer
mehr Lastwagen auf den Straßen
Der Güterverkehr hat sich seit den siebziger Jahren verdreifacht. Allein in den Jahren 1991-1997 nahm der Güterverkehr auf der Straße um 23 Prozent zu. Während Mitte der siebziger Jahre noch 26 Prozent des Güterverkehrs mit der Bahn erledigt wurde, sind es heute nur noch 16 Prozent.
Weil die Zahl der Lastwagen auf deutschen Straßen so rapide angestiegen ist, führte die Bundesregierung im Januar 1995 die zeitbezogene Autobahngebühr (Euro-Vignette) für Schwerverkehr ab 12 Tonnen ein. Seither bezahlt ein 40-Tonner - unabhängig davon, wie viele Kilometer er tatsächlich fährt - 2400 DM pro Jahr. Bei durchschnittlich 120000 km Fahrleistung im Jahr ist das ein kaum nennenswerter Betrag. Zusätzlich müssen Lkw-Besitzer - wie alle inländischen Straßennutzer - Kfz-Steuer und Mineralölsteuer zahlen. Dennoch ist sicher: Es klafft eine enorme Lücke zwischen den Einnahmen und den Kosten, die anfallen, wenn man die Folgeschäden des Straßengüterverkehrs beseitigen möchte.
Problematisch sind insbesondere die uneinheitlichen Wettbewerbsbedingungen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln. Im Gegensatz zur Straße trägt die Bahn ihre betriebswirtschaftlichen Infrastrukturkosten vollständig. Der Straßengüterverkehr dagegen kommt für die Kosten für Bau, Unterhalt, Betrieb und Überwachung des Straßennetzes nicht komplett auf - ganz zu schweigen von den externen Kosten, die er durch Unfälle, Umwelt- und Gesundheitsschäden verursacht. Ein 40-Tonnen-Lkw zerstört die Straßen im selben Maße wie 160000 Pkw. Die dadurch entstehenden Kosten werden jedoch nicht ihm, sondern der Allgemeinheit angelastet.
Der Gütertransport auf der Straße wurde in den letzten Jahren immer billiger und schneller. Allerdings auf Kosten von Klima, Umwelt und Gesundheit. Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, wird sich der Güterverkehr weiterhin zugunsten des Lkw und somit zuungunsten der Umwelt- und Lebensqualität entwickeln.
Es wird Zeit, dass der Rahmen geradegerückt wird: Eine faire Anlastung der entstehenden Kosten vermeidet unsinnigen Verkehr und schafft Anreize zur Verlagerung von Transporten auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel.
s 2. Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe - Forderungen des VCD
Der VCD fordert den Ersatz der heutigen Euro-Vignette durch eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Das bisherige Kostensystem, bei dem alle gleich viel zahlen, egal wie weit sie fahren und wie viele Kosten sie verursachen, ist zu starr. Es soll durch ein flexibles und faires Verfahren ersetzt werden, das den am meisten finanziell belastet, der die meisten Schäden bzw. Kosten verursacht. Die Schwerverkehrsabgabe soll eine fahrleistungsabhängige Gebühr für Schwerverkehr sein, die mit Hilfe von europaweit einsetzbaren Verfahren erhoben wird.
Die Höhe der Abgabe soll sich an den tatsächlich anfallenden Kosten für Bau und Erhalt des Straßennetzes und an externen Kosten orientieren. Mit den Einnahmen kann der längst überfällige Aufbau eines zukunftsfähigen Gesamtverkehrssystems gelingen. Das Straßennetz kann erhalten und das Schienennetz modernisiert werden. Städte und Gemeinden können die Einnahmen nutzen, um Straßenschäden zu beseitigen, den innerstädtischen Verkehr zu beruhigen oder die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
s
Beispiel bei 50 Pfennig/km:
Es gilt: Bei einer zwanzigfachen Erhöhung des derzeitigen Preises der Euro-Vignette durch die LSVA müsste ein 40-Tonnen-Lkw ca. 50 Pfg je gefahrenem Kilometer zahlen.
Das bedeutet zum Beispiel für Äpfel aus Südtirol: Ein 25 Tonnen schwerer Lastzug bringt 15 Tonnen Äpfel in eine 800 km entfernte deutsche Großstadt. Die Abgabe für die gesamte Ladung beträgt 240 DM. Das Kilo Äpfel verteuert sich somit für den Endverbraucher nur um 1,6 Pfg.
Unsinnige
Transporte vermeiden
Um zukunftsfähigen Güterverkehr zu fördern, ist die Vermeidung unsinniger Transporte und eine spürbare Verlagerung auf die umweltfreundlicheren Verkehrsmittel Schiene und Binnenschiff nötig. Damit die LSVA die gewünschten Verbesserungen erreichen kann, muss die Höhe der Abgabe von der zurückgelegten Entfernung, dem zugelassenen Gesamtgewicht des Lkw, den Schadstoffemissionen und dem verursachten Lärm abhängen. Somit folgt diese Abgabe dem Verursacherprinzip.
Um dieses Ziel zu erreichen, müsste das heutige Niveau der Euro-Vignette (2400 DM/Jahr) in der ersten Stufe mindestens auf das Zehn- bis Zwanzigfache angehoben werden. Eine Erhöhung auf das Zwanzigfache der Eurovignette - 50 Pfennig je Fahrzeugkilometer für einen 40-Tonner - würde zumindest die Infrastrukturkosten und einen Teil an externen Kosten abdecken.
Die Abgabe soll nach der Einführung etappenweise ansteigen, um mittel- bis langfristig Infrastruktur- und externe Kosten komplett den Verursachern anzulasten. Um starke Preissprünge im Übergang zur LSVA zu vermeiden, sollte schon jetzt der Preis der Euro-Vignette entsprechend angehoben werden.
Der VCD fordert, dass alle in- und ausländischen Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen in die LSVA einbezogen werden. Die Bundesregierung plant die Einführung für Fahrzeuge ab 12 Tonnen. Dies ist nicht ausreichend, da Lkw ab 3,5 Tonnen knapp 50 Prozent der Gesamtschäden am deutschen Straßennetz verursachen. Ein großer Teil der Lkw, die Schäden verursachen, würde nach der geplanten Regelung immer noch nicht für die Kosten aufkommen müssen.
Die Bundesregierung bemüht sich zur Zeit nur um eine Einführung der LSVA auf Autobahnen und nur innerhalb Deutschlands. Das kann allerdings nur ein erster Schritt sein. Um Verkehrsverlagerungen von Autobahnen auf Bundes- und Landstraßen zu vermeiden und alle Kosten gerecht anzulasten, muss die deutsche LSVA nicht nur auf Autobahnen, sondern auf allen Straßenkategorien erhoben werden. Der VCD setzt sich für eine europaweit gültige Schwerverkehrsabgabe ein, da Umweltprobleme nicht an den Landesgrenzen Haltmachen. Bis zu einer EU-Regelung ist jedoch nationales Handeln gefordert. Bisher hat nur die Schweiz eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe beschlossen. In Österreich und den Niederlanden ist sie - wie auch in Deutschland - im Planungsstadium. Da Deutschland ein wichtiges Transitland ist, hat die Einführung der deutschen LSVA Signalwirkung. Die europäischen Nachbarn beobachten die Entwicklung in Deutschland aufmerksam.
Um zu vermeiden, dass die Straßenspediteure den steigenden Finanzdruck an die Lkw-Fahrer weitergeben, fordert der VCD außerdem von der Bundesregierung, die Sozial- und Sicherheitsstandards für Lkw-Fahrer zu verbessern und endlich für deren effektive Durchsetzung zu sorgen. Die Einführung der LSVA muss daher von häufigeren Kontrollen der Lenk- und Ruhezeiten, einem generellen Nachtfahrverbot für Lkw innerorts und einer strikteren Ahndung der Regelverstöße begleitet werden.
s
3. Gute Gründe für eine LSVA
Mit Einführung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) werden die Wettbewerbsbedingungen zwischen den verschiedenen Verkehrsarten fairer. Die Bahn soll chancengleich mit dem Straßengüterverkehr konkurrieren können. Dazu muss der Straßengüterverkehr mittelfristig seine Infrastrukturkosten voll decken und auch für externe Kosten (z.B. Unfallkosten, Gesundheits- und Gebäudeschäden) aufkommen.
Dadurch, dass die durch den Güterverkehr entstehenden Kosten an den Verursacher weitergegeben werden, werden Anreize für eine Verlagerung der Straßengüter auf die umweltfreundlicheren Verkehrsmittel Schiene und Schiff gegeben. Diese Verlagerung auf ressourcenschonendere Verkehrsmittel ist wichtig, da mit dem Anstieg des Straßengüterverkehrs auch die Umweltprobleme (CO2-, Stickoxid- und Partikel-Emissionen sowie Lärm) zunehmen. Der Verkehrssektor verfehlt als einziger Sektor sein CO2-Ziel bei weitem. Mit jeder Tonne, die von der Straße auf die Schiene verlagert wird, könnte sich seine Umweltbilanz um den Faktor vier verbessern.
Gleichzeitig motivieren höhere Transportkosten Händler und Kunden zum Kauf regionaler Produkte. Die Transportwege verkürzen sich. Die Wettbewerbsbedingungen für die regionale Wirtschaft verbessern sich.
Wird der Straßentransport teurer, führt das außerdem zu einer besseren Auslastung jeder einzelnen Fahrt. Durch Vermeiden von Leerfahrten verringert sich automatisch das Verkehrsaufkommen. Das heißt: weniger Staus, weniger Lärm, weniger Abgase, weniger Unfälle und eine geringere Gesundheitsbelastung. So führt die Schwerverkehrsabgabe zu einem Zuwachs an Umwelt- und Lebensqualität.
Positive Nebeneffekte der LSVA bei der vorgeschlagenen Mittelverwendung sind außerdem die Finanzierung der Straßenerhaltung, die Modernisierung der Schiene und die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Auch die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der regionalen Wirtschaft, bei der Bahn und im Baugewerbe sind positive Begleiterscheinungen.
s
4. Einwände gegen die LSVA - und warum wir sie trotzdem brauchen
"Die
LSVA ist eine zusätzliche Belastung für die Wirtschaft."
Die LSVA ist kein Selbstzweck und verursacht keine neuen Kosten! Was zukünftig dem Straßengüterverkehr angelastet werden soll, sind bereits existierende Kosten. Die haben bisher die Steuerzahler zu tragen. Dies sind insbesondere: Staukosten, Unfallkosten, Kosten für Gesundheits-, Klima- und Umweltschäden oder Gebäudeschäden durch Abgase und Erschütterung sowie teilweise die Kosten durch die Straßenabnutzung. Es wird höchste Zeit, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, nach dem Grundsatz: Wer Schäden verursacht, soll auch dafür zahlen. Die LSVA wird für eine gerechtere Kostenverteilung sorgen und darüber hinaus helfen, weitere Schäden (= Kosten) zu minimieren.
"Die LSVA verteuert die Straßentransporte, das
wiederum hat eine Erhöhung der Verbraucherpreise zur Folge."
Damit eine LSVA die gewünschte Wirkung zeigt, muss sie in der Tat die Preise für Straßentransporte deutlich erhöhen. Legt man die Kosten aber auf die einzelnen Produkte um, stellt man fest, dass die Preiserhöhung für den Verbraucher sehr gering, ja teilweise kaum wahrnehmbar ist. Immerhin transportiert ein einzelner voll beladener Lkw beispielsweise etliche Tausend Hemden. Folglich ist der Anteil der Transportkosten an den Endkosten gering (etwa 5-10 Prozent).
Die Transporteure können die Kosten weiter senken: durch bessere Logistik und verbesserte Auslastung der heute oft nur halbvollen Lkw, durch die Verlagerung auf Schiff und Bahn, denn dort wird die Abgabe nicht erhoben, oder durch kürzere Transportwege bei regionaler Produktion.
Der VCD setzt sich auch dafür ein, dass die LSVA je nach Lärm und Luftschadstoffen aus den Auspuffrohren unterschiedlich hoch bemessen wird. Laute Lastwagen mit hohem Schadstoffausstoß bezahlen mehr als die Fahrzeuge, die beispielsweise die Euronormen 3, 4 oder 5 erfüllen und die neuesten Lärmgrenzwerte einhalten. Das bedeutet: Auch durch das Nachrüsten von Lkw auf schadstoffärmere Motoren lassen sich noch einmal Kosten sparen.
"Die
LSVA gefährdet Arbeitsplätze."
Diese Aussage ist so pauschal nicht richtig. Zwar mag es in der einen oder anderen Spedition Entlassungen geben. Dies steht jedoch in keinem Verhältnis zu den auf der anderen Seite neu entstehenden Arbeitsplätzen: bei der Bahn, der Binnenschifffahrt und im Kombiverkehr; bei der Bauwirtschaft und im Straßenerhalt. Außerdem fördert die LSVA die regionale Wirtschaft, wenn sich die Produktionsverlagerung in weit entfernte Billiglohnländer wegen hoher Transportkosten nicht mehr lohnt. Auch nationale Tourismusanbieter sehen einen engen Zusammenhang zwischen besseren Chancen in ihrer Branche und weniger Lkw-Verkehr. Deshalb haben in Deutschland einige Mitgliedsgemeinden der "Interessengemeinschaft autofreier Kur- und Fremdenverkehrsorte (IAKF)" auch schon erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Lkw-Verkehr zurückzudrängen.
"Nach der Einführung der LSVA werden viele Lkw auf
nicht kostenpflichtige Straßen ausweichen."
Zunächst werden die Lkw nicht überall auf Bundes- und Landstraßen ausweichen. Aber der Anreiz zum Ausweichen ist da, und daher fordert der VCD, nicht nur die Autobahnen, sondern alle Straßen in die LSVA einzubeziehen. Das ist nur logisch, denn die Kosten entstehen auf allen Straßen. Die Gefahr, dass Lastwagen, um Kosten zu sparen, auf Straßen in Wohngebieten ausweichen, muss unbedingt vermieden werden. Zudem finden ca. 80 Prozent der Fahrten in Entfernungen bis 150 km statt, ein Großteil davon im regionalen Bereich. Die Gefährdung z.B. durch Unfälle ist auf Bundes- und Landstraßen wesentlich höher als auf Autobahnen. Auch diese Kosten sollen die Verursacher tragen.
"Deutsche Spediteure haben durch die LSVA
verschlechterte Wettbewerbsbedingungen."
Das Gegenteil ist der Fall. Alle Lkw, die deutsche Straßen benutzen, müssen die LSVA bezahlen - und zwar für jeden Kilometer, der gefahren wird. Das gilt selbstverständlich auch für die ausländischen Fahrzeuge, sobald sie in Deutschland fahren. Damit fällt auch der Lohnkostenvorteil ausländischer Spediteure weniger ins Gewicht.
Darüber hinaus setzt sich der VCD gemeinsam mit europaweit fast 500 verschiedenen Organisationen für eine europaweite LSVA ein. Eine entsprechende Petition wurde im Herbst 1999 beim Europaparlament eingereicht. Ihre volle Wirkung im Sinne zukunftsfähiger Mobilität wird eine LSVA erst dann entfalten können, wenn sie in vielen Staaten gilt. Die Schweiz und Liechtenstein führen bereits eine eigene LSVA ein, Initiativen weiterer Staaten werden folgen. Deutschland kann in der EU eine Vorreiterrolle übernehmen.
"Eine
LSVA entspricht nicht dem europäischen Recht."
Dies gilt nur für die Einführung der LSVA auf Bundes- und Landstraßen. Eine
LSVA auf Autobahnen ist ohne Rechtsänderung möglich. Und: EU-Recht kann
verändert werden. Die grundsätzlichen politischen Zielsetzungen in Europa
befinden sich bereits in einem Wandlungsprozess. Es ist nur eine Frage der
Zeit, wann die entsprechenden Gesetze folgen.
Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang der Maastricht-Vertrag (der die volle Gültigkeit des Verursacherprinzips fordert) und die Aufgabenstellung des Wiener Regierungs-Gipfels (Dez. 1998) und des Kölner Gipfels (Juni 1999) (die die Integration von Umweltbelangen in alle Politikbereiche der EU vorsehen). Auch die EU-Kommission hat beispielsweise in ihrem Weißbuch "Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung" Kostenwahrheit zu einem wichtigen Anliegen gemacht.
Ein weiterer Beleg für die gewandelte Denkart in der EU stammt von Oktober 1999, als die EU-Verkehrsminister klar feststellten: Umweltbelange müssten bei verkehrspolitischen Entscheidungen gleichberechtigt neben Wirtschafts- und Sozialfragen berücksichtigt werden.
Die LSVA ist das Instrument, das europaweit sowohl von der Politik als auch von der Wissenschaft bevorzugt wird. Sie wird daher bei der notwendigen Gesetzesänderung mit an oberster Stelle für zukünftige EU-Richtlinien stehen. Mit der internationalen Petition im Oktober 1999 konnten schon konkrete Schritte für das Gesetzgebungsverfahren gemacht werden.
Einige
Beispiele zur Auswirkung der LSVA auf die Preise
Bei einer Jahresleistung von 50000 km hätte ein Spediteur eine Abgabe von 24000 DM zu zahlen. Für einen 7,5-Tonnen-Lkw, effizient im Nahverkehr eingesetzt, müssen bei 30000 km Fahrleistung 2700 DM gezahlt werden.
1. Stahltransport: Ruhrgebiet-Italien. Ein Lkw (40 Tonnen) fährt 20 Tonnen Stahl über 1250 km. Bei einem Abgabesatz von 1,2 Pfg pro Tonnenkilometer wäre eine Abgabe von 600 DM zu zahlen. Solche Transporte von schweren Massengütern über lange Distanzen würden sofort auf die Schiene verlagert.
2. Käse aus Frankreich: Ein 18-Tonnen-Lkw bringt 10 Tonnen Käse in eine 1000 km entfernte bundesdeutsche Stadt. Die Abgabe würde 216 DM betragen. Das Pfund Käse würde sich um etwa 1 Pfg verteuern. Das könnte jeder Käseliebhaber verkraften.
3. Erdbeeren aus Südspanien: Ein 25-Tonnen-Lkw fährt 15 Tonnen Erdbeeren in eine 3000 km entfernte bundesdeutsche Großstadt. Die Abgabe würde 900 DM betragen. Für das Pfund Erdbeeren müsste der Endverbraucher 3 Pfg mehr zahlen.
4. Regionaler Gemüsetransport: Mit einem 7,5-Tonnen-Lkw werden 3 Tonnen Gemüse zum nächsten Verbrauchermarkt gefahren. Die Distanz beträgt 50 km. Die Abgabe für die gesamte Ladung würde sich auf 4,50 DM belaufen. Die Beispiele gehen von einem Tonnenkilometerpreis von 1,2 Pfg aus.
s
5. Die technische Umsetzung - kein Problem
Es ist mit den heute gegebenen technischen Mitteln bereits möglich, eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe schnell, effizient und unbürokratisch zu erheben. Die Bundesregierung wird im Herbst damit beginnen, verschiedene technische Geräte und Erfassungsverfahren zu testen. Die Ausschreibung für ein System zur Erfassung läuft bereits.
Mehrere Verfahren sind denkbar: Als einfachste Lösung kann die sogenannte "black box", ein elektronischer Fahrtenschreiber, der ab 2002 für alle europäischen Lkw vorgeschrieben ist, die gefahrenen Kilometer registrieren. Oder eine Art Bordcomputer (On-Board-Unit = OBU), der den elektronischen Fahrtenschreiber der Lkw ersetzen kann. Stationäre Einrichtungen an den Straßen nehmen im Vorbeifahren Funkkontakt zur OBU auf. Sobald der Lkw die nächste Station passiert, wird die Strecke im Fahrzeug verbucht. Der Fahrzeughalter schickt seine Chipkarte regelmäßig an die Finanzbehörde oder eine andere Stelle, die dann den zu zahlenden Betrag errechnet.
Auch die Verwendung von GPS (Global Positioning System), mit dem bereits viele Lkw ausgestattet sind, ist möglich. In diesem Fall werden die Bewegungen des Lkw per Satellit beobachtet und an einen Zentralrechner weitergegeben. Dort können sie dann mit den übrigen Daten des Lkw zusammengebracht und ausgewertet werden. Der Fahrzeughalter erhält regelmäßig eine Abrechnung der entsprechenden Stelle.
Neben diesen weitgehend automatisierten Lösungen wird es für Wenigfahrer aus dem In- und Ausland auch manuelle Erfassungsmöglichkeiten geben.
s
6. Was bringt die LSVA Bevölkerung, Umwelt,
Verkehrsunternehmen und Wirtschaft?
… der Bevölkerung:
Da sich durch die Schwerverkehrsabgabe Verkehrsaufkommen, Staus, Lärm und Umweltbelastung verringern werden, erhöht sich die Lebensqualität für jeden einzelnen schnell und spürbar. Die Sicherheit im Straßenraum nimmt zu.
Autofahrer haben den Vorteil, weniger im Stau zu stehen. Außerdem nimmt mit der LSVA der Druck auf die Regierung ab, die Mineralölsteuer weiter zu erhöhen, um das Straßennetz erhalten und ausbauen zu können.
Im Handel werden vermehrt regionale Produkte angeboten. Nur die Preise für Güter, die über weite Strecken transportiert werden, werden steigen - allerdings in so geringem Maße, dass es im Einzelfall kaum spürbar ist. (siehe Preisbeispiele)
… der Umwelt:
Da mit der Einführung der LSVA das Aufkommen des Lkw-Verkehrs abnimmt (laut Berechnungen von T&E 16 Prozent weniger gefahrene Kilometer und eine um 9 Prozent verkürzte Gesamtfahrzeit), reduzieren sich die Mengen an CO2, Partikeln und Stickoxiden.
Da die Kosten für die Umweltverschmutzung in die Abgabe integriert sind, wird es für Motorenhersteller interessant, sauberere Motoren anzubieten.
… den Verkehrsunternehmen:
Zwischen den einzelnen Verkehrsanbietern wird es Chancengleichheit geben. Das führt - gemeinsam mit der schrittweisen Modernisierung der Bahn - dazu, dass die Bahn für viele Spediteure wieder attraktiv und ein Teil des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene verlagert wird.
Die Effizienz der Straßentransporte wird sich durch den Druck der Schwerverkehrsabgabe erhöhen. Für die Spediteure rechnet es sich, mit anderen Spediteuren zu kooperieren oder in fortschrittliche Logistiksoftware zu investieren. Dadurch nimmt die Zahl der leeren oder halbleeren Lkw auf den Straßen ab. Die Straßentransporteure zahlen erstmals für die Instandsetzung der durch ihre Fahrten zerstörten Straßen und für die Schäden an Umwelt und Gesundheit.
… der Wirtschaft:
Auch die Wirtschaft profitiert von der Schwerverkehrsabgabe. Lokale und regionale Unternehmen können dank ihrer kurzen Anfahrtswege mit Anbietern z.B. aus osteuropäischen Niedriglohnländern konkurrieren. In der lokalen Wirtschaft, bei der Bahn, bei der Binnenschifffahrt, im Kombiverkehr, im Baugewerbe und im Tourismus stabilisieren sich alte Arbeitsplätze und entstehen neue. Die Arbeitsplätze, die bei den Straßenspediteuren wegfallen, werden dadurch bei weitem kompensiert.
s
7. Die LSVA - längst überfällig
Sowohl die Kfz-Steuer als auch die zeitbezogene Straßenbenutzungsgebühr (Euro-Vignette) werden weder den ökologischen noch den ökonomischen Anforderungen und Zielen im Verkehrssektor gerecht, denn beide Abgaben sind unabhängig von den gefahrenen Kilometern. Sie schaffen also keinen Anreiz, Fahrzeuge besser auszulasten oder einzusparen. Eine Erhöhung der Kfz-Steuer hätte jedoch ebenfalls eine Reduktion der Treibhausgase zur Folge. Auch Straßenbau- und andere Instandhaltungskosten könnten durch eine erhöhte Kfz-Steuer gedeckt werden.
Eine erweiterte Haftpflichtversicherung würde die Kosten von Verkehrsunfällen abdecken. Sie kann jedoch die ökologischen Ziele und die faire Kostenverteilung der LSVA nicht erreichen.
Die Erhöhung der Mineralölsteuer könnte den Kostendeckungsgrad des Schwerverkehrs anheben. Auch in Bezug auf die Luftverschmutzung, die etwa proportional zum Treibstoffverbrauch ansteigt, würde sich die Gebühr anbieten. So hängt z.B. die Abnutzung der Straße vom Achsgewicht des Fahrzeuges, nicht aber vom Treibstoffverbrauch ab. Die alleinige Erhöhung der Mineralölsteuer würde aber nur zum Einsatz größerer und schwererer Lkw führen. Außerdem müssten komplizierte Ausnahmeregelungen getroffen werden, da die Besteuerung ebenfalls Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und ÖPNV-Busse einbezieht.
Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) ist daher die ökologisch sinnvollste, fairste und umfassendste Lösung.
s
8. Breite Unterstützung für die LSVA
Der VCD hat eine Petition zur Einführung einer leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) in Europa mitangestoßen. Verschiedene Organisationen und Verbände aus 27 Ländern unterzeichneten die Petition, darunter 121 Organisationen aus Deutschland, z.B. der Naturschutzbund Deutschlands (NABU), der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Euronatur, ROBIN WOOD etc. Neben etlichen Natur- und Umweltschutzverbänden unterstützen beispielsweise die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GED), der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), die Deutsche Bahn AG sowie diverse Interessengemeinschaften und christliche Einrichtungen die Petition zur LSVA.
Auch Wissenschaftler stehen hinter der LSVA. So spricht sich Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, Präsident des Wuppertal Instituts und Mitglied des Bundestages, für die Internalisierung der externen Kosten aus, so dass sich öko-effiziente Logistik- und Mobilitätskonzepte auf dem Markt durchsetzen.
Alle Bundestagsparteien bekennen sich zum Verursacherprinzip. Die CDU spricht sich "für eine europaweite Kostenwahrheit im Verkehr" aus. Diese Kostenwahrheit soll durch die Harmonisierung der Steuerbelastungen und durch die Anlastung der Wegekosten nach dem Verursacherprinzip erfolgen. Die Einführung einer schadstoff-, lärm- und tonnageabhängigen Schwerverkehrsabgabe für alle Lkw auf deutschen Straßen wird auch von den Jungen Liberalen angestrebt. Die Sozialdemokraten wünschen "zur Anlastung der Wegekosten die zeitabhängige Lkw-Vignette möglichst frühzeitig durch eine fahrleistungsabhängige elektronische Gebührenerhebung zu ersetzen". Dies hat sich auch in der Koalitionsvereinbarung mit Bündnis 90/Die Grünen niedergeschlagen. Diese fordern ebenfalls eine elektronisch erhobene Streckengebühr für Lkw.
Auch die Europäische Kommission unterstützt in ihrem Grünbuch (1995) und ihrem Weißbuch zur Verkehrspolitik (1998) die Forderung nach fairen und effizienten Preisen im Verkehr.
Der
Weg ist frei!
Selten hat es im Bereich der Verkehrspolitik einen breiteren parteienübergreifenden Konsens gegeben. Der Einführung einer leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe dürfte daher nichts mehr im Wege stehen. Der VCD wird darauf achten, dass die Abgabe so gestaltet ist, dass Mensch und Umwelt den größtmöglichen Nutzen davon haben.
März 2000
▲Rede von Kurt Bodewig, Bundesminister für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vor dem Plenum des Deutschen Bundestages 27.
September 2001
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich, bevor ich auf den Einzelplan 12 zu sprechen komme, angesichts der schrecklichen Ereignisse in den USA zunächst auf das Thema Flugsicherheit eingehen. Diese Ereignisse haben deutlich gemacht, dass unsere Verkehrssysteme verwundbar sind. Der Einsatz von Flugzeugen als Waffe war für uns nicht vorstellbar. Das ist eine neue Bedrohungssituation. Wir entsprechen dem durch konkretes und schnelles Handeln.
Wir haben direkt mit der Luftverkehrswirtschaft und den Sicherheitsdiensten Schlussfolgerungen gezogen und ein Maßnahmenpaket vereinbart, das jetzt zügig umgesetzt wird. Ich kann den Menschen in Deutschland versichern, dass an deutschen Flughäfen ein Höchstmaß an
Sicherheit hergestellt wird und dass wir diesen Prozess kontinuierlich verfolgen werden.
Ich komme jetzt auf den Einzelplan 12 und unsere Planung für das kommende Jahr zu sprechen. Dieser Einzelplan ist von 48 Milliarden auf 51 Milliarden DM gestiegen. Das Wichtigste ist: Er ist der größte Investitionshaushalt der Bundesregierung. Im Jahre 2002 werden wir 26 Milliarden DM investiv umsetzen. Da mit machen wir deutlich: Wir schaffen Arbeitsplätze, eine funktionierende Infrastruktur und Mobilität.
Das ist die Voraussetzung für eine gute Stadtentwicklung. Das in diesem Zusammenhang bestehende Gesamtkonzept besteht aus drei Instrumenten: erstens die klassische Städtebauförderung, zweitens das Programm "Soziale Stadt" und drittens das neue Stadtumbauprogramm Ost. Von 2002 bis 2009 wird die Bundesregierung 2,2 Milliarden DM allein in das Stadtumbauprogramm Ost investieren. Das ist ein neues und wirkungsvolles Programm.
Ich möchte den Ländern und Kommunen meinen Dank aussprechen; denn sie haben sich in diesen Prozess sehr produktiv eingebracht. Insgesamt werden wir in diesem Programmzeitraum über 5 Milliarden DM mobilisieren. Das führt zur Revitalisierung der Innenstädte in den neuen Bundesländern.
Nach diesen Bemerkungen zum Programm zur Verbesserung des Standortes Ostdeutschland nun zum Thema Verkehrsinfrastruktur. Ich möchte hier zwei Punkte besonders hervorheben. Erstens. Der Straßenbauhaushalt ist jetzt auf Rekordhöhe. Er beträgt im kommenden Jahr 10,8 Milliarden DM. Hinzu kommen 400 Millionen DM aus EFRE-Programm-Mitteln. Man kann also sehen: Wir nehmen unsere Verpflichtung, Mobilität zu gewährleisten, auch in diesem Programm ernst. 9 Milliarden DM werden hier investiert.
Zweitens - das ist mir genauso wichtig -: Wir haben die Investitionen in das deutsche Schienennetz deutlich erhöht. Die Angleichung an das Niveau der Straße mit einem Investitionsvolumen von annähernd 9 Milliarden DM macht dies deutlich. Es ist notwendig, weil gerade in Ihrer Regierungszeit diese Investitionen massiv heruntergefahren worden sind. Wir müssen jetzt endlich die notwendigen Investitionen realisieren. Ich meine, das ist nicht hoch genug zu schätzen.
Ich will aber auch deutlich machen, dass wir die Umsetzung dieser Mittel sehr genau verfolgen. Wir wissen, dass es bei den Planungskapazitäten der Bahn Nachholbedarf gibt. Deswegen wollen wir jetzt der Bahn entgegen kommen. Wir werden in diesem Bereich den Aufbau von Planungsreserven finanziell unterstützen. Nach meiner Meinung ist es eine wichtige und entscheidende Voraussetzung für die Umsetzung von Investitionen.
Aber ich will auch etwas anderes sagen. Das Geld ist nur ein Punkt. Ich glaube, die Zahlen des Bundeshaushalts für unseren Einzelplan können sich sehen lassen. Es sind Spitzenzahlen. Das ist gut so, weil dieses Geld gebraucht wird.
Verkehrspolitik bedeutet aber auch eine Weichenstellung, die sich auf den Haushalt gründen muss. Deshalb komme ich jetzt zur Verkehrsreform.
Wir stellen mit diesem Haushalt die Weichen für diese Verkehrsreform. Hierzu nenne ich drei Punkte.
Ich komme zunächst auf die Bahnreform zu sprechen. Teil der Verkehrsreform ist die Herstellung des fairen Wettbewerbs auf der Schiene. Das geht nur mit der Unabhängigkeit von Netz und Transport und der Sicherstellung des diskriminierungsfreien Zugangs.
Die zentralen Schlüsselelemente sind Trassenvergabe und Trassenpreisfestsetzung. Nicht über das Ob dieser Unabhängigkeit war zu beraten und zu entscheiden, sondern über das Wie und Wann. Mit diesem Ziel und diesem Auftrag habe ich die Task-Force Schiene eingesetzt. Sie sollte ergebnisoffen arbeiten und die unterschiedlichen Organisationsmodelle prüfen. Gestern Abend hat die Task-Force ihren abschließenden Bericht vorgelegt und wir haben Entscheidungen gefällt. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, Sie, die Abgeordneten, heute direkt zu informieren. Der Bericht geht Ihnen schriftlich zu. Herr Kollege Oswald, natürlich komme ich gern in den Ausschuss, um über diese Ergebnisse auch gemeinsam mit allen Mitgliedern des Ausschusses zu diskutieren. Ich will in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte nennen: s
Erstes Stichwort: Unabhängigkeit. Trassenpreisfestsetzung und -vergabe werden künftig unabhängig von der Holding getroffen. Weisungen und Vorgaben des Konzernvorstands wird es künftig nicht mehr geben. Satzung und Geschäftsordnung werden entsprechend den europäischen Vorgaben angepasst. Ich meine, das ist Entherrschung der Netz AG bei Trassenvergabe und -preisfestsetzung. Das ist notwendig.
Zweites Stichwort: Prozesskontrolle. Wir werden außerhalb der DB AG eine unabhängige Trassenagentur beim Eisenbahn-Bundesamt einrichten. Diese Agentur ist zuständig für die Diskriminierungsfreiheit von Trassenpreissystem und -vergabe. Das erfolgt in einer sehr massiven Weise. Sie begleitet die Fahrplanerstellung, sie garantiert die Diskriminierungsfreiheit des Netzfahrplans und stellt die Diskriminierungsfreiheit für die Trassenvergabe sicher. Diese Trassenagentur ist meinem Hause gegenüber berichtspflichtig. Damit wird ein ganz wirkungsvolles und effizientes Steuermittel geschaffen.
Drittes Stichwort: Transparenz. Künftig wird eine Reihe anderer Dinge transparent gemacht. Dazu gehören Leistungsbeziehungen im Konzern, konzerninterne Leistungsverrechnungen und die Preisfindungsmechanismen. Die Netz AG wird zukünftig eine eigene Bilanz veröffentlichen. Auch das hat es bis her nicht gegeben. Alle diese Maßnahmen sind mehr als notwendig und sie werden jetzt realisiert.
Viertes Stichwort: Maßnahmen bei Diskriminierung. Es wird festgelegt, dass Eisenbahn-Bundesamt und Bundeskartellamt die Einhaltung von Eisenbahnrecht und Wettbewerbsrecht sicherstellen. Hiermit werden der diskriminierungsfreie Zugang zum Netz und die Unabhängigkeit der Entscheidungen über Trassenvergabe und Trassenpreisfestsetzung gewährleistet.
Dies ist das Ergebnis einer beharrlichen Arbeit. Ich sage "beharrlich", weil eine Vielzahl von Prüfungen vorgenommen worden ist, die jetzt zu einem positiven Ergebnis geführt wurden, einem Ergebnis, das den diskriminierungsfreien Zugang und den Wettbewerb über diese Stellschrauben wirkungsvoll sicherstellt: Unabhängigkeit, Prozesskontrolle, Transparenz und Wettbewerbskontrolle. Ich sage Ihnen: Jetzt wird es ernst, jetzt kommt Wettbewerb auf die Schiene. s
Lassen Sie mich kurz die anderen beiden Vorhaben der Verkehrsreform ansprechen. Ich komme zunächst zur LKW-Maut. Sie ist ein ganz zentrales Steuerungsmittel zur Vermeidung und Verlagerung von Verkehr, das einen wirtschaftlichen Vergleich ermöglicht. Ich nenne Ihnen zu diesem Bereich fünf Punkte.
Erstens. Mit der Maut wird der LKW-Verkehr endlich mit seinen Wege kosten belastet.
Zweitens.
Die Maut verbessert den intermodalen Wettbewerb zwischen Schiene und Straße.
Drittens. Die Mittel fließen zurück in die Infrastruktur.
Viertens. Die Maut schafft Fairness im Wettbewerb. Sozialdumping und Billigangebote wird es nicht mehr geben. Es wird endlich eine faire Anlastung der Wegekosten geben. Das ist der entscheidende Punkt.
Fünftens. Die zur Erhebung der Maut nötige Technologie - dieser Punkt ist mir auch wichtig - wird dazu beitragen, die Exportchancen Deutschlands zu erhöhen. Ich sage dies, weil die Interessenten bei uns vor der Tür stehen. Mit dieser technologischen Innovation sind wir Vorreiter in Europa. Sie ist wichtig, weil sie nicht in den Verkehrsfluss eingreift.
Es ist eine wichtige Strukturentscheidung, die LKW-Maut zu erheben. Hierfür gibt es übrigens eine grundsätzliche Zustimmung aus Wirtschaft und Speditionsgewerbe. Es gibt einen Dissenzpunkt; diesen möchte ich ausdrücklich benennen: Es geht um die Querfinanzierung anderer Verkehrsträger.
Ich sage Ihnen: Diese wollen wir, weil jeder LKW, der nicht mehr fährt und dessen Ladung sich auf der Schiene befindet, die Mobilität insgesamt erhöht. Ich glaube, alle Verkehrsträger haben etwas davon, dass wir eine integrierte Verkehrspolitik machen.
Lassen Sie mich anfügen: Der ADAC hat gestern erklärt, dass er diese Konzeption, einschließlich der Querfinanzierung, mitträgt. Auch das ist, so denke ich, außerordentlich zu begrüßen.
Schließlich werden wir mit der Finanzierungsgesellschaft für Verkehrsinfrastruktur erreichen, dass die zusätzlichen Einnahmen aus der Maut in die Verkehrsinfrastruktur reinvestiert werden.
Lassen Sie mich abschließend sagen: Ich glaube, der Haushalt 2002 kann sich sehen lassen. Wir packen strukturelle Reformen an. Wir haben eine Spitzenausstattung bei den Mitteln für die Verkehrsinvestition. Das gab es bei Ihnen in den letzten fünf Jahren nicht mehr.
Wir haben einen Rekordhaushalt. Ich denke, dass dies die Konsequenz unserer Arbeit zeigt. Wir werden weitermachen.
Vielen Dank. ▲